Zwei Ringe und das Kriegsglück – eine moderne Parabel
Er stand auf seines Daches Zinnen,
er schaute mit vergnügten Sinnen
auf das beherrschte Samos hin.
„Dies alles ist mir untertänig,“
begann er zu Ägyptens König,
„Gestehe, dass ich glücklich bin.“
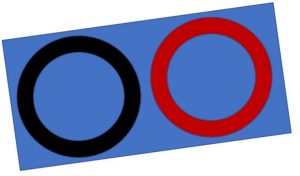
„Wer bist Du?“, fragt der Diktator seinen Gast. Der Fremde war, ohne anzuklopfen, eingedrungen in den Prachtsaal voller Gold und Stuck, aus dem der Diktator sein Reich befehligt.
„Ich bin Wotan, der Wanderer“, antwortet der Gast ohne Zögern. „Ich durchstreife die Welt.“
„Und kennst Du auch mein Reich?“, fragt der Diktator eitel.
Der Gast schweigt.
„Dann will ich es Dir zeigen, und Du wirst mich bewundern.“
Der Diktator öffnet eine unscheinbare Türe. Er geht voraus, und sie steigen eine schmale Treppe hinauf auf eine Terrasse. Sie ist, gut geschützt, in das Dach der stolzen Burg eingelassen. Mächtige Befestigungen umgeben die Burg, deren Pracht und Größe von grenzenlosem Reichtum und Wohlstand zeugen sollen. Gleich daneben glitzern die vergoldeten Zwiebelturmhauben der Kathedralen im Sonnenlicht.
Der Diktator ist bester Laune.
„Dies alles ist mir untertänig!“ ruft er im sanften Wind seinem Gast zu, und weist mit ausholender Geste im Halbkreis über sein Reich. Der Gast sieht eine prächtige Stadt, unter ihm liegt ein breiter, ruhig dahinströmender Fluss. Er sieht emsig eilende Autos, von hier oben klein wie Spielzeug. Am Horizont verliert sich weites grünes Land in der Unendlichkeit des Sichtbaren, Wälder, Wiesen, und wieder Wälder.
Der Blick des Gastes folgt der flachen Hand des Diktators, die nach Westen zeigt. Vor der Weite des Landes funkelt ein prachtvoller Ring an seinem Finger.
„Hier entlang marschieren meine Truppen,“ prahlt er. „Wir werden weitere Provinzen erobern!“, Dann blickt er zu seinem Gast. „Gestehe, dass ich glücklich bin!“
Der Wanderer zögert. Dann widerspricht er. Ob der Herrscher nicht sehe, welche Gefahren überall lauern? Jederzeit könne er Opfer einer Palastrevolte oder eines Aufstandes werden, schon viele Diktatoren vor ihm wurden auf dem Höhepunkt der Macht grausam ermordet, warum nicht auch er? „Dich kann mein Mund nicht glücklich sprechen,“ mahnt Wotan kopfschüttelnd, „solang des Feindes Auge wacht!“
In diesem Moment kommt ein Soldat aus der Leibgarde des Diktators heraufgeeilt. „Schau her, was wir verhindert haben!“, ruft er stolz und deutet auf den Bildschirm seines Handys. „Ein Attentäter wollte Euch stürzen, aber wir haben ihn mit Gift ausgeschaltet!“ Der Diktator lächelt, nimmt das Gerät und zeigt seinem Gast das Bild eines toten Mannes.
Der Wanderer tritt einen Schritt zurück. „Kein schönes Bild“, versetzt er mit besorgtem Blick. „Und doch warn´ ich Dich, dem Glück zu trauen. Bedenke die Gefahr fremder Armeen, die sich an den Grenzen Deines Reiches versammeln!“
Da winkt der Diktator seinen Assistenten heran, der still am Rand der Dachterrasse gewartet hatte und nun ein Notebook aufklappt. Eine Tabelle erscheint auf dem Bildschirm. „Wir mögen 100.000 Männer verloren haben in unserem Kampf, aber wir können noch Millionen neue und bessere heranziehen,“ rechnet er vor. Dann mustert der Diktator seinen Ring. „Ich habe die Macht. Alles wird mir gefügig sein.“
Das Notebook piepst. Eine Pushmeldung des Geheimdienstes flackert auf. Der Diktator und sein Gast lesen sie: Die Länder, die dem Überfallenen zu Hilfe geeilt sind, liegen im Streit darüber, ob sie mehr Waffen liefern sollen oder besser nicht?
Der Diktator lacht laut auf. Doch der Gast erbleicht. „Dein Glück ist heute gut gelaunt“, stammelt er, „doch fürchte seinen Unbestand!“ Der Wanderer schreitet auf der Terrasse hin und her. Dann setzt er hinzu: „Kennst Du die Geschichte des Polykrates?“
„Na klar,“ antwortet der Diktator, „er beherrschte die Insel Samos, war reich und glücklich, und auf dem Höhepunkt seines Glücks warf er seinen liebsten Ring ins Meer.“
„Stimmt,“ bestätigt der Gast. „Er wollte die Götter besänftigen, falls sie zürnen ob seines Übermaßes an Glück. Aber Polykrates bekam den Ring zurück, weil am nächsten Tag ein Fisch gefangen wurde, in dessen Bauch er lag.“
Der Diktator grinst. Der Wanderer jedoch bleibt ernst. „Er war sich seines Glückes zu sicher. Bald schon danach wurde Polykrates in eine Falle gelockt und getötet.“
„Gute Geschichte“, antwortet der Diktator und macht eine wegwerfende Handbewegung. Dicht und drohend hält er den prächtigen Fingerschmuck seinem Gast vor das Gesicht. „Aber ich bin nicht Polykrates, und das hier ist nicht sein Ring. An die Götter der Griechen glaube ich nicht. Ich muss niemanden beschwichtigen, und deshalb würde ich auch niemals diesen wunderbaren Ring in ein Meer werfen.“
„Woher hast du ihn?“, flüstert der Gast.
„Erobert“, antwortet der Diktator schmallippig.
Wieder betrachtet er den Ring von allen Seiten. Er holt tief Luft, blickt in die Ferne. „Der Ring gehörte einst den Nibelungen, einem germanischen Sagenvolk. Es war ein schweres Stück Arbeit, ihn zu beschaffen. Ich musste Blut vergießen und töten, Verträge und Versprechen brechen, Frauen betrügen, Vertraute beiseite räumen.“
„Und nun?“
„Nun habe ich die Macht und den Reichtum, mein Land so erstrahlen zu lassen, wie es ihm gebührt. Ich werde den Willen fremder Länder brechen und sie unterwerfen. Generationen nach mir wird mein Volk mich noch bewundern und verehren.“ Der Diktator fixiert seinen Gast, und setzt dann hinzu: „Dieser Ring ermöglicht meine Taten, und meine Taten werden mich unsterblich machen.“
Wotan wendet sich ab. „So kann ich hier nicht ferner hausen“, raunt er leise. „Fort eil ich, nicht mit Dir zu sterben.“ Schnellen Schrittes strebt er der Treppe entgegen.
„Sterben? Ich bin nicht Polykrates!“ ruft ihm der Diktator trotzig hinterher.
Da ist der Gast schon nicht mehr zu sehen. Er stürmt in großen Schritten hinab vom Dach der Burg. „Mag sein,“ ruft er dem Diktator durch das Treppenhaus noch zu, „aber auch dieser Ring wird Dein Verderben sein.“
Schon erreicht der Wanderer den Ausgang des Schlosses, stürmt vorbei an den Wachen, täuscht die Kontrolleure, kurvt geschickt herum um die Sperren und Zäune, eilt hinab in die lebendige Stadt, wohl wissend, dass die Schergen des Diktators ihm auf den Fersen sind.
Atemlos erreicht er den großen Fluss, sucht ein Versteck und erlaubt sich einen verborgenen Moment der Rast. Wie lange mag sie gedauert haben? Immer wieder erwartet Wotan die Schritte und Schreie seiner Verfolger, aber schließlich hört er stattdessen anschwellendes Rauschen. Das Wasser des Flusses, der gerade eben noch lautlos dahinströmte, kräuselt und schäumt, steigt an, kocht und brodelt. Wogende Wellen schlagen erst sanft, dann heftig an das Ufer, schon ist die erste Straße überschwemmt, die vorbeifahrenden Autos bremsen und schlingern, Menschen springen heraus und suchen Rettung am höherliegenden Gemäuer. Aber das Wasser wird immer mehr, es steigt und steigt, tobt und wogt.
Auch den Wanderer erfassen die Fluten, eine unerbittliche Woge reißt ihn mit. Im Wasser treibend, ringend mit der Kraft der Elemente, blickt er hinauf. Lodernde Flammen schlagen aus der prachtvollen Burg, auf deren Dach er einst gestanden hatte, ein entsetzliches Inferno verschlingt dort die ganze Pracht des Diktators. Rauchende Trümmer stürzen hinab in den ansteigenden, alles mit sich reißenden Schwall.
Da schlägt ein harter, kleiner, fester Gegenstand im brodelnden Chaos der aufschäumenden Wassermassen gegen seine Hand. Wotan greift danach, verfehlt ihn, versucht es nochmals, kämpft gegen die tobenden Wellen, die ihn hinaustreiben in die neue Zeit. Nochmals greift er zu, und fischt dann das Kleinod aus dem Nass.
Er muss nicht überlegen. In weitem Bogen wirft er den Ring hinaus in die chaotische Sintflut, damit er für alle Zeiten unauffindbar verloren bleiben möge.
Diese Parabel ist meine persönliche Auseinandersetzung mit dem 1. Jahrestag des Beginns des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Sie spiegelt meine Hoffnung wieder, dass eines Tages das System stürzen wird, das diese Aggression zu verantworten hat.
Die Vorstellung, Ringen könnten magische Kräfte innewohnen, fasziniert die Phantasie der Menschen schon seit der Antike bis heute (z.B. „Der Herr der Ringe“ von Tolkien). Die (nicht zeithistorisch belegbare) Geschichte über das Ring-Erlebnis des Polykrates wurde vom Antikendichter Herodot überliefert, der wenige Jahre nach dem Tyrannen Polykrates von Samos lebte (beide ca. 500 v.Chr.). Inspiriert zu meinem Text hat mich die auf Herodots Schilderung basierende, faszinierend schöne Ballade Friedrich Schillers über den „Ring des Polykrates“.
Auch der Besuch aller vier Vorstellungen des „Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner an der Oper Stuttgart trug dazu bei, mich an diese Ring-Parabel zu wagen. Als vollständiger Zyklus ist der Wagner-„Ring“ im Frühjahr in Stuttgart zweimal zu sehen: Vom 3. bis 12. März und vom 4. bis 10. April (jeweils an vier Abenden). Mehr dazu hier: https://www.staatsoper-stuttgart.de/spielplan/der-ring-des-nibelungen/
Für jeden Teil des neuen Stuttgarter „Ring“ habe ich eine verkürzte, moderne Inhaltszusammenfassung erstellt, und dabei auch meine Eindrücke und aktuellen Assoziationen zusammengefasst. Diese Texte finden Sie hier: