Als Zuschauer beim „Literarischen Quartett“ – eine Erfahrung
Das Sprechen über Literatur steckt voller Risiken. „Nicht verraten!”, schreit der eine, wenn das Gegenüber ansetzt, die Pointe aus dem Buch zu erzählen, das er gerade liest. „Völlig langweilig”, hört überrascht die Leserin das fremde Urteil über den Roman, den sie gerade so packend findet. Die euphorische Empfehlung „Das Buch ist ganz toll!“ ist verantwortlich dafür, dass Abertausende ungelesene, im Lesen abgebrochene Bücher die Regale und e-Reader füllen, und auch dafür, dass die Verlage damit sogar noch Geld verdienen.
Die Welt, die sich im eigenen Denken beim Lesen eines Buches entfaltet, ist eine individuelle Eigenproduktion, eine Einmaligkeit, ein Solitär. Darüber zu sprechen, eröffnet für viele weniger einen Blick auf Literatur, mehr auf die Sprechenden. Und doch, oder deshalb, treffen sich täglich im ganzen Land Menschen, suchen erkaltete Salons von Volkshochschulen auf oder bewirten sich in privaten Zirkeln mit Weißwein und Käsehäppchen, um über Bücher zu sprechen.

Ein bildungsbürgerliches Hochamt
Wenn es ganz öffentlich, auf einer Bühne, übertragen im nächtlichen Fernsehen, abrufbar zu jeder Tageszeit in den Mediatheken, stattfindet, dann kann das Sprechen über Bücher zum bildungsbürgerlichen Hochamt werden. Seit dem Jahr 1988 streiten in der Sendung „Das literarische Quartett” im ZDF Literaturkritiker/innen und andere über Bücher. Das legendäre erste Quartett mit Marcel Reich-Ranicki, Hellmuth Karasek und Siegrid Löffler (die Reihenfolge war Programm) ging am 30. Juni 2000 im heftigen Streit auseinander. Man kann sich den Moment der öffentlichen Implosion der Literaturkritik auch heute noch auf YouTube ansehen und es ist zu empfehlen, dies zu tun.

Das Filmchen ist ein Zeitdokument darüber, dass sich in den seither vergangenen 23 Jahren die Dinge zwischen Männern und Frauen zumindest in der Öffentlichkeit doch ein wenig zum Guten verändert haben. Der noch ohne den geringsten Anflug von Selbstreflexion agierende Kultur-Großfürst Reich-Ranicki hatte sich vor laufender Kamera zu persönlichen, sexistischen Bewertungen über das Liebesverständnis seiner aus Wien stammenden Literatur-Kritiker-Kollegin Loeffler verstiegen. Das hatte nicht etwa das Ende seiner eigenen Mitwirkung an der Sendung zur Folge, sondern den Rückzug von Löffler. Die allerdings wusste ebenfalls auszuteilen, gegen das Buch, aber auch gegen die „erotischen Vorlieben” ihres männlichen Kollegen. Im Mittelpunkt des spektakulären Schlagabtauschs stand das Buch „Gefährliche Geliebte” von Haruki Murakami, was im weiteren Verlauf dieser Erlebnisschilderung noch eine Rolle spielen wird.
Bald darauf verordnete das ZDF dem Quartett eine Sendepause. 2015 wurde es in neuer Besetzung wiederbelebt, und seit 2020 leitet die Schriftstellerin mit dem Künstlernamen Thea Dorn die Kritikerrunde, die außer ihr selbst keine festen Partner mehr hat. Dorn und das ZDF suchen sich in jeder Sendung neu drei wechselnde Prominente aus der Welt der Worte, und um die 100 Zuschauer sitzen artig um das Podest im Großen Salon des Berliner Ensemble herum, wenn die Scheinwerfer aufleuchten.
Kabelgewirr, nervös gewittriges Blinken, Giraffenarme
Der technische Aufwand ist enorm. Ein Gewirr von Kabeln, nervös gewittriges Blinken der Displays und Bildschirme prägen die vorfreudige Atmosphäre im Foyer des dunkelholz-getäfelten Theaterbaus am Schiffbauerdamm. Eine Heerschar von Fernsehfachleuten versucht die Technik in Schach zu halten, – besser noch: – auf Höchstform zu trimmen, jeden Ton einzufangen, das Licht richtig zu setzen, um die Heldinnen und Helden der Literaturkritik im richtigen Winkel einzufangen. Lautlos kreisen die giraffenartig ausgreifenden Kameraarme durch den Raum, schweben geisterhaft hinweg über die Köpfe der gutgelaunten Zuschauerschar, die sich schon Wochen vorher eine Karte gesichert hatte für die Aufzeichnung des „Literarischen Quartett” Ende März 2023.
Wer über eine solche Karte verfügt, wird handverlesen gesetzt. Keine freie Platzwahl bei der Literatur. Es soll ausgebucht aussehen (was es ist), vielleicht auch divers und kameratauglich. Zuvor mussten die Besucher Mantel und Handy abgeben, damit keine Störfrequenz die sensible Technik irritiert. Und kein unbotmäßiges Klingeln. Wie wäre es mit unkontrolliertem Herumschreien? Nun ja, hier ist alles unter Kontrolle, nicht live. Es ist eine Aufzeichnung, und ein Flitzer unter Literaturfreunden könnte zur Not herausgeschnitten werden. Aber niemand aus der Schar der Bücherfreunde ist hergekommen, um die eigene Meinung zu den Büchern einzubringen. Klatschen ist erwünscht; es wird eingeübt, wie lange der aus Regiesicht optimale Beifall andauern sollte – fünf Sekunden, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Zweimal ist sich der Wort-Adel einig
Dann – Auftritt der Matadore. Thea Dorn als erste; einer ihrer Mitdiskutanten trottet mit ihr vorab auf die Bühne, aber die Chefin schickt ihn wieder zurück. Die Gastgeberin erläutert nochmals das Prozedere: Man werde sich erst einmal warmdiskutieren, was dann später nicht im Fernsehen zu sehen sein wird. Sie stellt ihre Mitkritiker vor, auch das ist exklusiv für das Live-Publikum der Aufzeichnung, denn in der ausgestrahlten Sendung wird das ein Intro-Film erledigen. Diesmal sind dabei: die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck und die Literaturkritiker Adam Soboczynski (ZEIT) und Philipp Tingler (Schweizer Fernsehen SRF) . Vier Bücher stehen zur Diskussion, und man kann das Ergebnis so zusammenfassen: Bei zwei Büchern ist sich der Wort-Adel weitgehend einig, dass sie gut sind. Bei einem scheiden sich die Geister: zwei dafür, zwei dagegen.
Schließlich kommt das Buch dran, das der Autor dieser Zeilen gerade liest; es wird vorgestellt von Jenny Erpenbeck, die tapfer für ihren Kollegen Arno Geiger kämpft. Aber es hilft nichts. Die drei anderen vernichten „Das glückliche Geheimnis“ als „wirklich ärgerlich und entbehrlich“ (Philipp Tingler). Man muss Arno Geiger nicht auf eine Stufe mit Haruki Murakami stellen, wenn an dieser Stelle an den Zwist zwischen Sigrid Löffler, Marcel Reich-Ranicki und Hellmuth Karasek erinnert wird. Löffler sprach damals der „Gefährlichen Geliebten“ jede literarische Qualität ab, sprach von „literarischem Fastfood“, kanzelte den japanischen Roman als „sprachloses, kunstloses Gestammel“ ab, was den schon beschriebenen Streit auslöste. Und doch wird noch immer jedes Jahr spekuliert, wann endlich Murakami den Literatur-Nobelpreis bekommen wird.
„Wie ein Schuss aus dem Betäubungsgewehr“
Die Vernichtung des Geiger-Buches im aktuellen „Quartett“ kommt ohne vergleichbare persönliche Schärfe im Disput aus. Selbst wenn das kritisierte Buch eine „Wirkung hat wie ein Schuss aus dem Betäubungsgewehr“ bleiben Verletzungen aus. Allesamt sind sie interessiert am gepflegten Diskurs, die bösartige Streitkultur von einst ist längst abgewandert in andere Medien.
Es ist eine wohlige, bildungsbürgerlich kultivierte Szene, die da zusammenkommt, auf der Bühne wie im Publikum. Hier ein graues Haar, dort ein elegant um den Hals gelegter Schal. Philipp Tingler testet die Grenzen der fernsehtauglichen Kleiderordnung aus und trägt ein schrilles T-Shirt. Das war es aber schon.
Selten ist der Zweifel so kultiviert zu haben wie hier

Ein großer Spiegel verdeckt für die Fernsehaufzeichnung die Glastüren, die sonst vom Salon auf den Balkon des Berliner Ensembles führen. Man könnte dort hinaustreten und bekäme Bert Brecht zu sehen, der in Bronze gegossen auf dem Platz vor „seinem“ Theater sitzt. „Von den sicheren Dingen das sicherste ist der Zweifel“, hat der Theatermann einmal gesagt. Selten ist der Zweifel in unserer wilden Welt noch so kultiviert zu erleben wie beim „Quartett“, wo sich im großen eitlen Spiegel das Licht der Scheinwerfer bricht. Sie beleuchten eine Welt, die sich gefällt, aber berührungslos fremd bleibt für die Bäckereiverkäuferin, die mit den Folgen der Inflation kämpft, für den Müllwerker, der an seine Familie in der fernen Heimat denkt, oder für die Mutter, die sich über den Notfallplan ihrer Kinderkrippe beugt.
Nach einer knappen Stunde ist die gut ausgeleuchtete Spiegelei vorbei, der von Licht und Menschen aufgeheizte Raum leert sich schnell, die wohlgesetzten Worte sind schon verhallt, die Kritiker verabschieden sich artig, und die Zuschauer treten hinaus an die frische Luft. Das Handy brummt, die reale Welt meldet sich.
Was jetzt tun mit dem abgekanzelten Geiger-Buch: Wegschmeißen oder weiterlesen? Es war unterhaltsam, das Sprechen über Literatur zu erleben. Am besten aber ist wohl: Man liest.
Die aktuelle Folge des „Literarischen Quartett“ wurde am 31.3.2023 ausgestrahlt und ist noch bis 30.6.2023 in der ZDF-Mediathek verfügbar.
Ich empfehle unbedingt, sich auch den legendären Streit im „Quartett“ vom 30. Juni 2000 auf YouTube anzusehen: https://www.youtube.com/watch?v=IFCSHEfQvY4
Weitere Texte als #Kulturflaneur finden Sie hier.
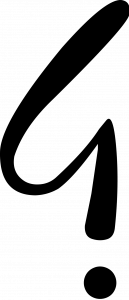
 Was Markus Söder und Thomas Mann gemeinsam haben
Was Markus Söder und Thomas Mann gemeinsam haben
