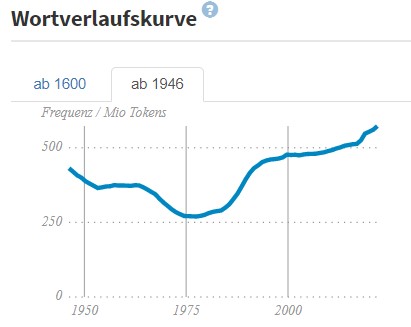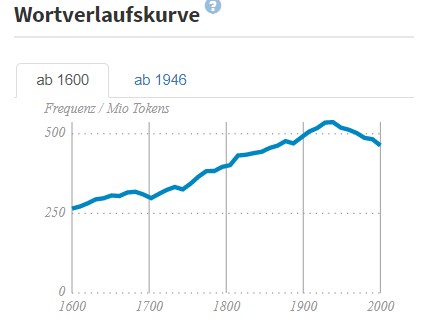Ein Kneipengespräch
„Vergiss die Politik!“ Der Fußballfan hat wohl schon ein paar Bierchen intus und das Deutschland-Shirt von der vorletzten WM zeigt deutliche Flecken aus vorangegangener Begeisterung. Aber macht nichts, denn in der Kneipe ist das Licht schummrig, die Luft schwer und alle gucken auf den Bildschirm. Österreich gegen die Türkei.

„Vergiss die Politik“, sagt der Fußballfan nochmal, wischt sich die Finger am Deutschland-Shirt ab und schwenkt das leere Bierglas. Ums Treseneck herum sitzen die beiden fremden Freunde, treffen sich hier zum ersten Mal, und spielen mit ihren Bierdeckeln. „Denk nur an den ganzen Quatsch mit Binde in Katar und irgendwelchen Arbeitssklaven und so, das war alles Politik,“ setzt der Fußballfan wieder an. Mit Schwung stellt er das leere Glas auf die Theke zurück. „Und was war dann: Schlecht gespielt haben sie.“
Sein Gegenüber ist ein Demokratiefan und wackelt mit dem Kopf hin und her. Dann zupft er sich das graue Poloshirt zurecht. Es ist warm und dampfig in der Kneipe. Draußen regnet es.
„Vergiss die Politik im Fußball“, kommt da nochmal vom Fußballfan, während er der Wirtin hinter dem Tresen winkt. Ein fragender Blick zu seinem Nachbarn, ein entschlossenes Nicken, dann werden zwei Finger gehoben in ihre Richtung.
„Irgendwie ist doch immer alles politisch“, sagt der Demokratiefan. „Gerade in Katar. Dass man da einfach in einer üblen Diktatur spielt und so tut, als gäbe es das nicht: die unterdrückten Frauen und das Verbot für Schwule und das alles. Der ganze Aufwand mit gekühlten Stadien, die jetzt leer stehen. Da kann man doch nicht weggucken. Wenn das nicht Politik ist!“
„Schon. Aber hat nix mit dem Spiel zu tun. Beim Fußball kommt es auf Fitness an, auf Kondition, und auf die gute Technik, dass sie schnell rennen können, eine Taktik haben und auf den Trainer. Das hat doch nix mit Politik zu tun.“
„Frei im Kopf müssen sie auch sein, die Spieler.“
„Ja schon, frei im Kopf ist immer gut. Ideen müssen sie haben, mal was Neues zu machen, nicht den Ball immer nur hin und her zu schieben.“
Zwei neue Biere kommen …
Die Wirtin stellt zwei Bier auf den Tresen. Saftige Schaumkronen liegen auf dem lockenden Goldgelb. Sie stoßen an.
„So muss ein Bier sein“, sagt der Fußballfan und wischt sich den Schaum von der Lippe. „Hat auch nix mit Politik zu tun.“
„Auch Bier ist politisch, vor allem der Preis“, sagt der Demokratiefan. „Es sind schon Revolutionen wegen des Bierpreises ausgebrochen.“ Er trinkt. „Aber lassen wir das. Wer ist schon alles rausgeflogen bei der Europameisterschaft?“
„Ha! Die Italiener!“ Der Fußballfan grinst.
„Siehste, die Italiener. Nicht frei im Kopf, weil sie eine postfaschistische Regierung haben.“
Der Fußballfan nimmt einen tiefen Schluck und glotzt ins Leere. „Was für ´ne Regierung?“
„Postfaschistisch. Super-autoritär. Die Meloni mag ja ganz freundlich gucken. Aber sie will die Pressefreiheit abschaffen und sich fette Macht auf immer sichern. Fast so wie der Orban.“
„Orban ist Ungarn, oder? – Auch rausgeflogen.“
„Eben: Der nächste Autokrat, der seinen Fußballern keinen Gefallen damit tut, dass sie nicht frei sind im Kopf. Ich sage: Wenn die Regierung keine Freiheit zulässt, spielen die Fußballer schlecht.“
„Jetzt Moment mal“, rafft sich der Fußballfan auf, strafft das verschwitzte Deutschland-Trikot und hebt den Zeigefinder. „Willst du mich hier in so eine Politikscheiße reinquatschen? So nach dem Prinzip, wer schlecht regiert wird, verliert im Fußball?“
„Na ja, kann man doch mal überlegen. Wer hier schon alles rausgeflogen ist, pass auf…“
„Nee, nee,“ protestiert der Fußballfan und winkt ab, „Politik hat mit Fußball nix zu tun.“
„Jetzt hör´s Dir doch wenigstens mal an. Also: Ungarn raus, Orban ist ein Diktator. Italien raus, frühere Faschisten regieren. Serbien raus, Vucic ist ein übler Putin-Freund und zündelt im Balkan. Slowakei raus, auch so ein spalterischer Populist hat da das Sagen, Fico heißt er. Will der Ukraine keine Waffen liefern. Georgien raus, da machen sie gerade ein Gesetz zur Unterdrückung aller kritischen Meinungen.“ Der Demokratiefan nimmt einen tiefen Schluck aus dem Glas. „Also, so ist es, und jetzt kommst Du.“
Der Fußballfan schüttelt den Kopf. „Das ist doch alles Blödsinn. Die Spieler da von diesen Ländern, die haben doch mit ihrer Regierung gar nichts zu tun, die spielen doch alle bei uns oder in Italien, Frankreich oder in England!“
„Das mag schon sein,“ entgegnet der Demokratiefan, „aber im Kopf sind sie doch in ihren Ländern zu Hause – oder etwa nicht? Muss ja auch so sein. Verlangen wir doch auch von unseren Migranten, wenn sie für Deutschland spielen. Von Tar oder von Musiala oder von Rüdiger, die sollen sich doch auch im Kopf voll und ganz mit Deutschland identifizieren. Gündogan hat türkische Eltern. Trotzdem singt er die deutsche Hymne, wenn’s los geht, und das ist doch auch richtig so.“
„Ja schon, aber das ist doch was anderes.“
„Warum?“
„Weil … weil … ach, keine Ahnung. Aber überhaupt, wenn das stimmen würde, was Du da redest, dann müssten die Deutschen ja auch schlecht spielen, weil wir doch auch ganz mies regiert werden von der Ampel. Tun sie aber nicht.“
„Andersrum stimmts! Die spielen gut, weil sie den Kopf frei haben, weil wir gar nicht so schlecht regiert werden. Verstanden?“
Der Fußballfan ist nicht überzeugt. „Die spielen besser als zuletzt, sagst Du, weil der Scholz so gut regiert? Das glaubst Du doch selber nicht.“
„Na, ja, das vielleicht nicht. Jedenfalls gibt’s hier aber nichts, was die Freiheit im Kopf begrenzt. Außer eigener Blödheit. Und das ist in Ungarn und Serbien und Georgien echt anders, da kannst Du ratzfatz ins Gefängnis wandern, wenn Du was Falsches sagst. Und wenn wir nicht aufpassen, ist das bald auch in Italien so. Und deshalb verlieren die alle.“
„Krass – das glaubst Du echt?“
„Ja sicher“, antwortet der Demokratiefan. „Unfreiheit im Land führt zu Unfreiheit im Kopf. Und das führt zu schlechtem Fußball. Klarer Zusammenhang.“
Die Türken spendieren eine Runde Raki …
Lautes Jubeln und Gegröle im Lokal. Das Spiel ist aus. Autohupen auf der Straße. Eine Gruppe feiernder Türken stürmt herein.
„Da hast Du Deinen Blödsinn!“ schreit der Fußballfan im Getümmel und prostet den türkischen Fans zu. Der Tresen wird umringt von Jubelnden, während eine rote Halbmond-Fahne die beiden Biergläser ins Wanken bringt. „Die Türken feiern!“, brüllt der Fußballfan, „und das ist doch nun wirklich keine gute Regierung dort. Korrupt, alles wird immer teurer, und als Frau willste da auch nicht leben, ewig daheim und mit Kopftuch und so.“ Einen tiefen Schluck nimmt der Fußballfan aus dem Glas, richtet sich neu auf, verschafft sich Platz zwischen den Feiernden um ihn herum, und ruft: „Das ist der Gegenbeweis!“
Die feiernden Türken verstehen zwar nichts die vom Gespräch, geben aber eine Lokalrunde Raki aus. Einige zeigen den sogenannten „Wolfsgruß“, ein Symbol für radikalen türkischen Nationalismus. Der Demokratiefan schüttelt den Kopf. „Gar kein Gegenbeweis,“ sagt er. „Die Türken haben die Österreicher rausgeworfen, weil beide nicht frei sind im Kopf. Siehst Du an dieser komischen Nationalismus-Geste.“ Das Rakiglas wird auf den Tresen gestellt. „Die Österreicher sind gerade drauf und dran, eine Super-Rechtspartei zum nächsten Wahlsieger zu machen. In diesem Spiel haben eben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die beide nicht den Kopf frei hatten. Einer musste ja gewinnen.“
„He, jetzt hab´ ich Dich!“, schreit der Fußballfan und kippt den Schnaps in sich hinein. „Das mit der Wahl gilt auch für Frankreich! Da haste Dir jetzt selbst widersprochen. Die Franzosen werden die rechtsradikale Le Pen auch wählen, und trotzdem haben sie gewonnen!“
Der Demokratiefan greift zum Rakiglas, überlegt und schiebt es dann voll zurück. „Ja schon … aber wie! Erst in der allerletzten Minute hat´s gereicht. Das war vor allem Glück. Und außerdem haben sich die französischen Spieler ganz öffentlich gegen den drohenden Rechtsruck in Frankreich ausgesprochen. Das ist wie Doping für Freiheit, das hilft auch für die Freiheit im Kopf.“
Die türkischen Fans ziehen wieder ab, der nächsten Kneipe entgegen.
Nochmal zwei frische Biere …
Die Wirtin blickt zu ihnen hinüber, zwei Finger gehen hoch.
„Und was sagste zur Ukraine?“, fragt der Fußballfan. „Wenn die nicht eine gute Regierung haben, wer denn dann? Halten ihren Staat irgendwie am Laufen, sogar die Bahn fährt da pünktlich, was wir hier nicht hinbekommen, und nebenbei müssen sie ihr Land verteidigen.“ Zwei frische Biere werden auf den Tresen gestellt. „Und dann fliegen sie in der ersten Runde schon raus, als Gruppenletzter.“
„Das war bitter. Stimmt,“ räumt der Demokratiefan ein. „Aber die hatten eben den Kopf auch nicht frei, wer will es ihnen verübeln in ihrer Situation? Außerdem hatten sie besonderes Turnierpech. Die waren Vierter in ihrer Gruppe mit vier Punkten. Das war mehr als die Slowenen hatten, die Gruppendritte wurden und weiterkamen. Voll ungerecht.“
„Hat eben doch nichts mit Politik zu tun. Ist alles nur Fußball.“
Die Tür geht auf, eine Gruppe Österreicher trottet herein. Lautstark bestellen sie Bier. Die Enttäuschung über das Ausscheiden gegen die Türkei klingt bereits ab.
„Sag mal?“, fragt der Demokratiefan.
„Ja was?“
„Macht schon Spaß, so eine EM in Deutschland, oder?“
„Logisch! Es regnet zwar dauernd, aber trotzdem ist überall beste Stimmung. Alle freuen sich, siehste ja gerade, sogar ich kann mich mit den Türken freuen, und mit den Österreichern traurig sein.“
Sie beide prosten den Österreichern zu, die hinter ihnen stehen und gerade ihre Biergläser bekommen haben. „Seid´s arg traurig?“, fragt der Fußballfan. Die Österreicher trinken.
„Hat vielleicht auch was mit der Demokratie zu tun,“ sagt der Demokratiefan. „Gute Stimmung gibt’s nur in Freiheit, nicht in einer Diktatur.“
„Du nervst. Ich freu´ mich jetzt aufs Viertelfinale,“ sagt der Fußballfan und nimmt einen Österreicher in den Arm. „Leider ohne Euch. Aber tolle Spitzenmannschaften kommen da jetzt: Spanien, Portugal, Frankreich, Niederlande, England, Schweiz. Und Deutschland! Das werden super spannende Spiele!“
„Alles lupenreine Demokratien“, sagt der Demokratiefan.
„Da hätten wir auch reingehört“, ruft ein Österreicher. „So demokratisch wie die Niederländer sind wir noch lange.“ Der Demokratiefan lacht.
Fünf Biere hatten die Schotten ausgegeben …
„Jetzt hört doch mal auf mit dem Politikzeug!“, ruft der Fußballfan. „Und überhaupt, was ist mit den Schotten und Deiner Theorie? Die haben besonders gute Stimmung gemacht, unglaublich, fünf Bier haben sie mir ausgegeben, hier an diesem Tresen, und eine Demokratie sind sie auch, oder? Trotzdem rausgeflogen.“
„Ja, stimmt alles, aber leider haben sie einfach zu schlecht Fußball gespielt,“ sagt der Demokratiefan.
„Siehste,“ triumphieren da der Fußballfan und die Österreicher. „Ist eben Fußball. Hat nix mit Politik zu tun.“
Weitere Texte als #Politikflaneur finden Sie hier.
Eine Liste aller Krawalle und „Revolutionen“, die vom Bierpreis ausgelöst wurden, findet sich auf Wikipedia.
Wer mehr über die Hintergründe des „Wolfsgruß“ erfahren möchte, findet eine gute Zusammenfassung hier.