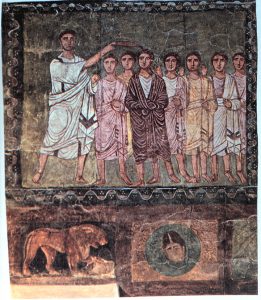Was wir sozialen Rüpeln, Populisten, Besserwissern und Hetzern im neuen Jahr nicht mehr durchgehen lassen sollten
Deutschland zittert. Nicht nur vor der Januar-Kälte, sondern auch vor den Konflikten und Wahlen des neuen Jahres. Dabei hätte dieses Land alle Chancen, seine freiheitliche Ordnung zu erhalten, den breiten Wohlstand zu sichern und die aktuellen Krisen zu bewältigen, vielleicht sogar gestärkt aus ihnen hervorzugehen.
Wichtiger als klick-gieriger Alarmismus wäre es, dass sich die wohlwollende Mehrheit in Deutschland neu darauf verständigt, auf welcher Grundlage wir zusammenleben wollen. Wer wach durch unseren Alltag geht, erlebt Zumutungen, an die wir uns nicht gewöhnen sollten, egal welchen politischen Standpunkt wir jeweils einnehmen, die wir nicht praktizieren wollen und auch nicht ertragen wollen, wenn es andere tun.
Hier ein Vorschlag für Zehn Gebote für das Miteinander in einem freiheitlich-demokratischen Deutschland und gegen die Spaltung unserer Gesellschaft:
(1) Verhalte Dich rücksichtsvoll
Eine Gruppe Jugendlicher feiert Silvester. Sie haben sich mit Böllern eingedeckt, es kracht und scheppert nach Herzenslust. Damit es noch lauter wird, werfen sie die Knallkörper in eine fremde Tiefgarageneinfahrt. Den Müll lassen sie liegen.
Die Bereitschaft und Sensibilität für Rücksicht ist eine zentrale Basis unseres Zusammenlebens. Es gibt keine Freiheit ohne Rücksicht. Freiheit als simple Durchsetzung der eigenen Interessen führt zu massiver Unfreiheit vieler. Nicht jeder Schaden, nicht jede Beeinträchtigung ist rücksichtslos, beabsichtigt oder vermeidbar. Aber das allgegenwärtige Bemühen, größtmögliche Rücksicht zu üben, würde das gesellschaftliche Klima grundlegend zum besseren verändern.
(2) Achte Deine Mitmenschen, wer und wie auch immer sie sind
 Karl Lauterbach postet auf X (Twitter) ein Foto mit sich und seinem Doktorvater Amartya Sen, Nobelpreisträger für Ökonomie, der inzwischen 89 Jahre alt ist. Neben Sen steht dessen Frau: Emma Rothschild. Es ergießt sich über Lauterbach eine Flut von antisemitischem Hass und düsteren Verdächtigungen.
Karl Lauterbach postet auf X (Twitter) ein Foto mit sich und seinem Doktorvater Amartya Sen, Nobelpreisträger für Ökonomie, der inzwischen 89 Jahre alt ist. Neben Sen steht dessen Frau: Emma Rothschild. Es ergießt sich über Lauterbach eine Flut von antisemitischem Hass und düsteren Verdächtigungen.
Menschen aufgrund irgendwelcher Wesensmerkmale anders zu beurteilen als alle anderen Menschen, ist inhuman und widerspricht den Werten des Grundgesetzes: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ (Art. 3 GG).
Dort steht nicht, dass man bestimmte Menschen mögen muss. Niemand muss sich individuell anfreunden, sie einladen, ihnen helfen, sie unterstützen. Aber das Gegenteil ist unethisch und zudem oft verboten. Traditionelle, kulturelle und moralische Übereinkünfte regeln unser Zusammenleben. Für viele Situationen gelten darüber hinaus regulär zustande gekommene Gesetze. Innerhalb dieses Rahmens gilt: Jeder ist zu akzeptieren so, wer oder wie er ist. Ohne Wenn und Aber.
(3) Übe Respekt
Die junge Frau steht an der Supermarktkasse, das Handy zwischen Kopf und Schulter geklemmt. Sie telefoniert. Den Mann an der Kasse würdigt sie keines Blickes, das Gespräch unterbricht sie nicht. Er ist kein Mensch für sie, nur eine Funktion.
Am Anfang jeder Begegnung steht Respekt. Im menschlichen, wie im demokratischen Diskurs darf Respekt erwartet werden, gegenüber jeder Meinung, jeder Herkunft, jeder Einstellung. Auf dieser Grundlage gilt es, Meinungsverschiedenheiten auszutragen, sich für oder gegen eine Fortsetzung des Kontaktes zu entscheiden. Respekt ist eine Haltung, Respektlosigkeit eine Beleidigung.
Respekt endet dort, wo er auf Respektlosigkeit trifft. Gegen Intoleranz und Verleumdung ist aktives Handeln mit den Mitteln des Rechtes und der öffentlichen Auseinandersetzung angezeigt.
(4) Verteidige das Recht
Der Weihnachtsbaum, gerade noch bestaunter Mittelpunkt des Wohnzimmers, liegt am Straßenrand. Ein paar Plastikkugeln baumeln noch daran, niemand hat sich die Mühe gemacht, das nun plötzlich lästig gewordene Grünzeug kompostierfähig dorthin zu bringen, wo es gesammelt werden kann.
Auf der Parkbank liegt bergeweise Müll, Pizzakartons, halbleere Flaschen, Getränkebecher, Plastiktüten. Hier wurde gefeiert.
Es gilt Tempo 40, alle paar Meter steht ein Schild. Kinder springen auf dem Gehweg herum, Eltern schieben Kinderwagen. Da braust mit aufheulendem Motor der SUV heran und jagt vorbei, legt sich mit quietschenden Reifen in die nächste Kurve.
In Deutschland gilt das Recht auf der Basis von Gesetzen. Es ist aus gutem Grund geregelt, wie schnell wir fahren dürfen, wohin wir unseren Müll zu entsorgen und wie viele Steuern wir zu bezahlen haben. Gegen diese Regeln absichtsvoll zu verstoßen oder sie zu ignorieren, gefährdet das Wohl der Allgemeinheit.
Nicht überall kann Polizei stehen. Und nicht jede Regel ist in jeder Situation relevant. Gerade deshalb ist jede und jeder Einzelne gefordert, das eigene Handeln auf die Wirkung für die Allgemeinheit zu reflektieren, Regeln zu kennen, sie einzuhalten und für ihre Einhaltung zu werben.
(5) Sieh hin, wenn Dir Not begegnet
„Laut Paritätischem Armutsbericht 2022 hat die Armut in Deutschland mit einer Armutsquote von 16,9 Prozent im zweiten Pandemie-Jahr (2021) einen traurigen neuen Höchststand erreicht. 14,1 Millionen Menschen müssen demnach hierzulande derzeit zu den Armen gerechnet werden, 840.000 mehr als vor der Pandemie. “ (Paritätischer Wohlfahrtsverband)
Menschlichkeit ist eine Haltung. „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Mit diesem Satz beginnt das deutsche Grundgesetz. Existenzielle Not und Armut sind in jedem Fall Verstöße gegen die Würde des Menschen, und zwar auch dann, wenn sie eventuell ganz oder teilweise selbst verschuldet sind. Es kann tausend gute Gründe geben, warum der einzelne sich nicht in der Lage sieht, durch eigenes Handeln das Leid auf der Welt zu lindern. Nicht jeder kann oder will spenden. Nicht jede muss sich engagieren. Und auch Deutschland als Staat kann sich gewiss nicht alles Leid auf der Welt aufladen.

Die Alternative dazu ist nicht das Wegsehen. Wegsehen ist das Gegenteil von Menschlichkeit. Wenigstens das Wahrnehmen, eine empathische Sicht auf die Not um uns herum und in der Welt, darf in einer humanen Gesellschaft von jedem und jeder erwartet werden.
(6) Hüte Dich vor der Lüge
„Die Grünen stehen letztendlich für diese Kultur: Nein, nein, nein. Verbot, Verbot, Verbot. Nur das einzige Mal überhaupt sind sie bei etwas nicht fürs Verbot. Es gibt nur eine Geschichte, wo die Grünen für eine Erlaubnis sind: Das sind Drogen.“ (Markus Söder im Bierzelt Trudering, 12.5.2023)
Die Lüge ist das böse Gift des Zusammenlebens. „Du sollst kein falsches Zeugnis geben“, lautet das achte der zehn christlichen Gebote. Niemand muss eine bestimmte Meinung teilen. Jeder darf mit Argumenten fechten, auch mit Zuspitzungen, im persönlichen Gespräch genauso wie im öffentlichen Diskurs. Aber die pure Lüge ist unsittlich, genauso wie absichtsvolles, böswilliges Missverstehen des Gegenübers.
(7) Überwinde die Gleichgültigkeit gegenüber unseren Lebensgrundlagen
„Ab dem 4. Mai 2023 leben wir ökologisch gesehen auf Kredit: Wenn alle Menschen auf der Welt so leben und wirtschaften würden wie wir in Deutschland, wäre bereits an diesem Tag das Budget an nachhaltig nutzbaren Ressourcen und ökologisch verkraftbaren Emissionen für das gesamte Jahr aufgebraucht.“ (Germanwatch)

Was sichert den Wohlstand? Die Industrie und der Mittelstand, die Startups und die Handwerker, die Arbeitsplätze bereitstellen. Die globale, vor allem europäische Vernetzung unserer Volkswirtschaften. Das Engagement und die Veränderungsbereitschaft der Menschen, die sich in die Prozesse der Volkswirtschaft einbringen. Deshalb haben wir Arbeit, deshalb zahlen wir Steuern.
Das alles stimmt. Aber wenn wir dabei die Grundlagen unseres Lebens zerstören, dann sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen. Diese Herausforderung ist existenziell und unbestreitbar. Es gibt gute Gründe, über die richtigen Wege aus dieser Situation zu streiten. Wer ihr aber mit Gleichgültigkeit begegnet und gar so tut, als gäbe es das Problem nicht, oder als gehe es ihn nichts an, der spricht oder handelt verantwortungslos.
(8) Achte das Eigentum der Gemeinschaft
„Graffiti-Schmierereien machen den größten Anteil von Vandalismus bei der Deutschen Bahn (DB) aus. In bundesweit knapp 24.000 von insgesamt rund 35.000 Fällen seien im vergangenen Jahr Schäden durch Graffiti festgestellt worden, teilte eine Bahn-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit.“ (rbb)
„Open Piano nach zwei Tagen zerstört“ – eine engagierte Bürgerin hatte in Stuttgart im Sommer 2023 ein Klavier in eine U-Bahn-Unterführung gestellt und geschmückt. Alle Beteiligten waren einverstanden, niemand hatte einen Schaden, viele eine Freude. Es war als Angebot an Passanten gedacht, „im Vorbeigehen“ ein kleines Klavierstück zu spielen. An einem Freitag aufgestellt – schon am darauffolgenden Sonntag war es zerstört, die Dekoration zerfetzt. In zwischen wurde es repariert.
Der öffentliche Raum ist das Wohnzimmer der Gesellschaft. Vandalismus ist ein Anschlag auf fremdes, gemeinschaftliches Eigentum, er verletzt Gefühle der Mitmenschen, und das Eigentum aller – strafbar ist er noch dazu. Vandalismus hinzunehmen oder zu verharmlosen, bedeutet, die Werte der Gemeinschaft als disponibel zu betrachten.
(9) Wenn Du Verantwortung trägst, sorge für Funktionsfähigkeit
„Der durchschnittliche Zeitaufwand für einen Amtsbesuch in einer Großstadt betrage 2 Stunden und 18 Minuten, in einer mittelgroßen Stadt 2 Stunden und 20 Minuten und in einer Kleinstadt 2 Stunden und 21 Minuten.“ (FOCUS Online unter Bezug auf eine Umfrage von Bitkom, 3.1.2024)
„Derzeit beträgt die Bearbeitungszeit für einen Wohngeldantrags 14 Monate.“ (Eine Amtsleiterin in Stuttgart).
So wie die Bürger ihren Pflichten gegenüber dem Staat nachzukommen haben, so muss auch der Staat sein Leistungsversprechen halten. Überbordende Bürokratie, fehlende Digitalisierung, unsinnige Formulare, schleppende Abläufe untergraben die Identifizierung des Einzelnen in den freiheitlichen Staat. Daher tragen alle dort besondere Verantwortung für das Gelingen des Zusammenlebens. Sie haben für angemessene Funktionsfähigkeit zu sorgen.
Diese Prinzip gilt immer, auch in der freien Wirtschaft. Für den Staat und seine Institutionen gilt es aber in besonders hervorgehobener Weise. Im Umgang mit Behörden ist der Bürger Kunde. Er ist angewiesen auf eine funktionsfähige Verwaltung, denn er hat dazu keine Alternative. Mangel an Personal ist keine Rechtfertigung für versagende Funktionalität, sondern Ausdruck für ein Versagen in der Wahrnehmung von Verantwortung.
Dies alles begründet jedoch keine unangemessene Anspruchshaltung gegenüber der Verwaltung. Der Staat muss sparsam wirtschaften, daher kann er nicht beliebig viele Ressourcen bereitstellen.
(10) Gestalte die Veränderung
„So soll es sein, so kann es bleiben, So hab´ ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt.“ (Liedtext Annette Humpe / Adel Tawil)
Nichts bleibt, wie es ist. Im Privaten kann jeder Mensch versuchen, seine Dinge so zu belassen, wie er sie sich geordnet hat. Wer aber sein Haus verlässt, stellt fest: Alles ändert sich. Alles ist anders als vor zehn oder zwanzig Jahren. Und es wird in zehn Jahren anders sein als heute.
Wer also der Gesellschaft in Aussicht stellt, dass die Dinge so bleiben könnten, wie sie sind, ist unredlich. Wer Veränderungen gestaltet, Vorschläge dazu macht, Verantwortung übernimmt, handelt im Interesse des Gemeinwohls. Über den Umgang mit Veränderung zu streiten, ist notwendig und richtig. Die Notwendigkeit zur Veränderung selbst zu leugnen, ist unehrlich und respektlos gegenüber den kommenden Generationen.
Alles Selbstverständlichkeiten?
Umso besser. Wenn nur die Mehrheit unserer Gesellschaft im neuen Jahr danach handelt und nicht mehr hinnimmt, dass dagegen verstoßen wird, dann werden sie schnell verschwinden: Die Sozialrüpel, die großen Verführer, die Billighändler der einfachen Wahrheiten, die bösartigen Hetzer gegen die Menschlichkeit. Lasst uns beginnen!
Weitere Texte als #Politikflaneur finden Sie hier.