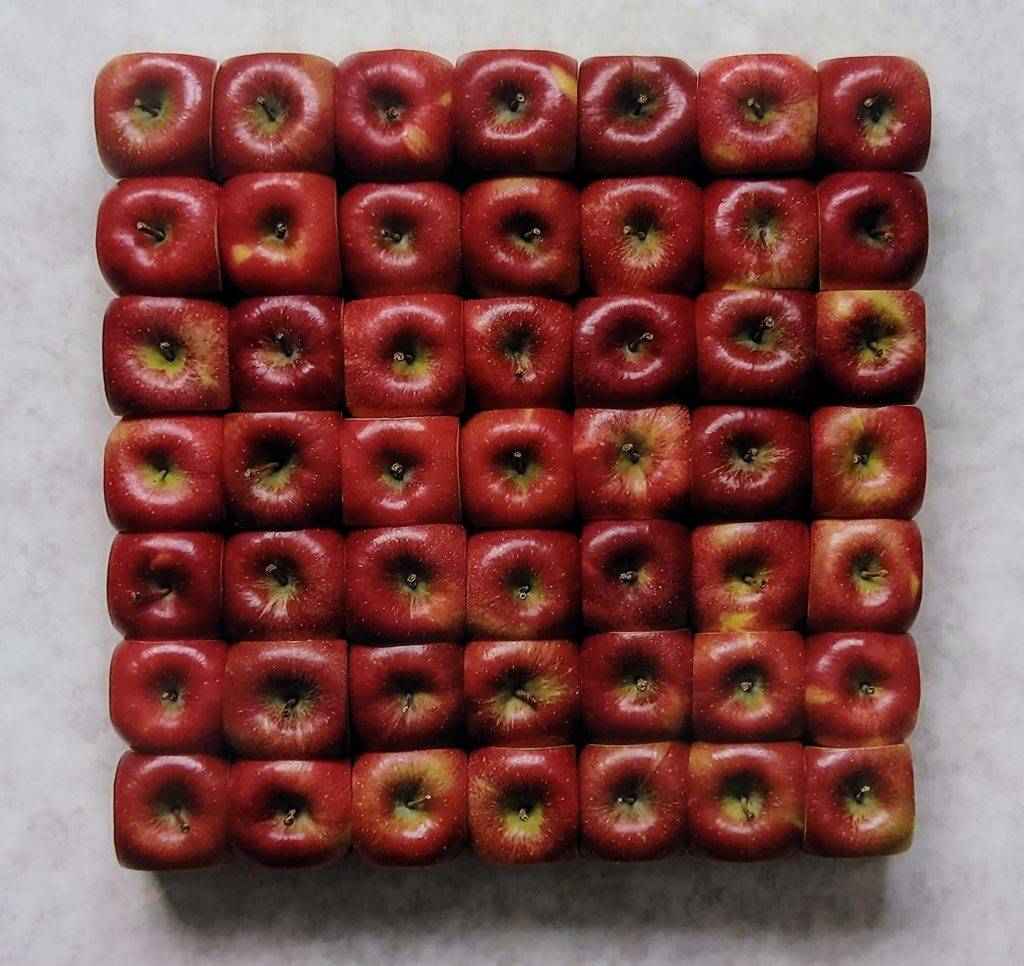Nachdenken über Jeff Walls Fotokunstwerk „Restoration“ – und den neuen Bahnhof von Stuttgart
Eine junge Frau blickt in die Weite. Sie hat dunkle Haare, ein scharf geschnittenes Gesicht, trägt eine Brille aus dünnem, dunklen Metall. Sie steht auf einem Baugerüst, stützt sich auf das provisorische Geländer. Hinter ihr ist eine weitere Frau von hinten zu erkennen, die sich mit feinem Pinsel an der Wand zu schaffen macht. Auf den zweiten Blick versteht der Betrachtende: Das sind keine Handwerkerinnen. Kleine Papierzettelchen markieren weitere Stellen, die der sachkundigen Aufmerksamkeit der beiden Frauen bedürfen. Sie renovieren ein Gemälde, das viel größer ist als sie selbst. Es ist etwas wahrhaft Großes, an dem sie arbeiten.

Diese Zeilen beschreiben einen Ausschnitt aus einem sehr großen Foto. Das hinterleuchtete Bild misst fast fünf Meter in der Breite und 120 Zentimeter in der Höhe, und ist im Besitz des New Yorker Museum oder Modern Art (MoMA). Komponiert hat es der kanadische Fotokünstler Jeff Wall im Jahr 1993. Noch bis 21. April ist es im Rahmen einer Ausstellung in der Fondation Beyeler in Basel zu sehen.
Zu sehen ist eine Baustelle
Die beiden Frauen auf dem Foto stehen im Vordergrund, aber eigentlich ist eine Baustelle zu sehen. Gerüste wurden gebaut, eine Plattform als Arbeitsbühne in die Mitte aus grobem Holz zusammengezimmert. Das „Bourbaki-Panorama“ in Luzern wurde renoviert, als es entstand. Von dem Riesengemälde in seinem Hintergrund sind heute etwa 1000 Quadratmeter erhalten. Sie zeigen die Entwaffnung eines Teils der französischen Armee zum Ende des deutsch-französischen Krieges 1870/71. Gemalt hat es der Künstler Edouard Castres im Jahr 1881; die Renovierung des Kunstwerkes hat sieben Jahre gedauert.

Walls Foto heißt „Restoration“ und erzählt nichts über den Krieg, über die Verzweiflung der unterlegenen Soldaten, die Not der Menschen und die Hilfsbereitschaft, die ihnen begegnete. Das alles ist Thema des Panoramabildes. Das große Foto fängt nur einen einzigen Moment ein – den der Meditation, des demütigen Innehaltens der jungen Frau, ihres Nachdenkens über die Größe der Aufgabe, die ihr und ihrer Kollegin gestellt ist. Wann werden sie jemals damit fertig sein?
„Wann wird er endlich fertig sein?“
Vierzehn Jahre wurden von Baubeginn an benötigt, um den neuen Flughafen in Berlin fertigzustellen. Sechzehn Jahre lagen zwischen ersten Planungen und der Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie. „Wann wird er denn nun endlich fertig?“ fragen die Menschen, wenn sie am alten Stuttgarter Kopfbahnhof ankommen und nun schon seit Jahren absurd lange und beschwerliche Umgehungswege hinter sich bringen müssen, um vom maroden Bahnsteig in der taubenverdreckten, zugigen Resthalle, in die Innenstadt oder auch nur zur Anschluss-S-Bahn zu gelangen. Wann wird er endlich fertig, der neue Bahnhof?
Eine Gelegenheit, sich davon ein Bild zu machen – es gewissermaßen der Restauratorin bei Jeff Wall gleichzutun und in die Weite zu blicken – , hat die unter der Riesenbaustelle leidende Bevölkerung alle Jahre an Ostern. Bei „Tagen der offenen Baustelle“ drängen sich die Massen der Neugierigen unter spinnennetzartigem Gerüstgewirr hindurch, stolpern über Metalltreppen und provisorisch ausgebreitete Schalungsbretter durch die Wunde im Herzen Stuttgarts, still staunend und emsig fotografierend. Mehr als 100.000 Besucher waren es dieses Jahr an den drei Tagen, an denen sie eingeladen waren, das auch nach jetzt dreißig Jahren Planung und zwölf Jahren Bauzeit noch immer unvollendete Werk zu besichtigen.
Die Fülle der Aufgaben gleicht einer Hydra
Es ist die Größe einer Aufgabe, die verstummen lässt. Einen solchen Bahnhof zu errichten – in diesem Fall: ihn hineinzugraben in den Untergrund des Zentrums einer Großstadt – gleicht einem geradezu babylonischen Plan. Die elegant geschwungenen Kelchstützen, die komplexen Lichtaugen, die ganze unfassbare Vielfalt und Vielzahl der Aufgaben, die hier geplant und abgearbeitet werden müssen, mit Abermillionen Details, Kabelanschlüssen, Dichtungen, Bewehrungen – sie alle gemeinsam gleichen einer Hydra: jedes gelöste Problem trägt die Gefahr in sich, dass sich zwei neue Herausforderungen auftun. Schließlich ist das, was zu sehen ist, erst der Rohbau, was wird noch alles folgen müssen: Gleise und Bodenbeläge, Lampen und Schilder, Papierkörbe und Signale, Treppen und Aufzüge, Kioske und Toiletten, Bänke und Automaten. Wann wird all das endlich fertig sein?
Die Größe einer Aufgabe macht demütig
Der Blick der jungen Frau vor ihrer Renovierungsarbeit ist kein Blick von Resignation, kein Protest, keine Gleichgültigkeit. Es ist ein Blick der Ergebenheit. Die Größe einer Aufgabe macht demütig. Hier ist keine Ungeduld zu sehen, auch keine Erschöpfung. Die Restaurierung wird brauchen, viele Stunden, Wochen, Monate, Jahre. Aber am Ende wird sie gelingen.

Noch kein Zug rollt durch die kühle, hohe Halle des neuen Stuttgarter Bahnhofs. So ist ausreichend Platz, dass sich sogar die Massen der Neugierigen verlaufen. Sie blicken in die Weite dieses fast 450 Meter langen Raumes, hinauf in die Höhe, die man dem Untergrund abgerungen hat, sehen hinweg über herumstehende Baustellenfahrzeuge, Dixi-Klos und gestapelte Materialien. Es wird viel länger dauern, als vor vielen Jahren berechnet wurde. Es wird mühsamer sein und teurer sowieso. Die Größe der Aufgabe fordert ihren Tribut.
Der weite Blick in die künftige Kathedrale der Züge
600 Jahre haben Menschen am Kölner Dom gebaut. Es hat sich gelohnt, denn wer heute unter seinen gotischen Bögen steht, versteht Geschichte. Ungezählte Menschen haben an ihm gewirkt, ihn in die Höhe getrieben und bekämpfen bis heute seinen Verfall. Es ist wie in der künftigen Kathedrale der Züge von Stuttgart: Am Ende sind es nicht die Besserwisser und Kritiker, die ein großes Werk schaffen, nicht die Zweifler und ungeduldigen Nörgler. Es sind die Menschen mit einem Blick für das Weite. Die, die einen kühner Plan fassen und genauso die, die ungezählte Details verwirklichen, hier ein Kabel, dort eine Schraube. Irgendwann wird das Ganze größer sein als wir selbst, und etwas erzählen von uns, wenn wir es selbst nicht mehr erzählen können.
Die Fotokunstwerke von Jeff Wall sind eine Reise nach Basel wert. Die Ausstellung seiner großformatigen Werke in der Fondation Beyeler ist noch bis 21. April zu sehen.
Fotos und Animationen über den Stand der Baustelle für den neuen Stuttgarter Bahnhof gibt es massenhaft im Netz, z.B. hier.
Weitere Texte als #Kulturflaneur finden Sie hier.