Eine wahre Geschichte in Deutschland
Es könnte ein Film sein über ein jüdisches Leben in Deutschland, erzählt wie so viele „nach einer wahren Geschichte“: Auf dem Land wächst eine junge Frau auf, eingebettet in einer großen Familie mit ihren Konflikten, Freuden und Leiden. Mit Nachbarn, mit denen sie ihre Religion teilt, wie es schon ihre Eltern getan haben und auch ihre Großeltern. Mit Gewohnheiten und Veränderungen, mit Abneigungen und Sehnsüchten, mit bangen Erwartungen und bitteren Enttäuschungen. Vielleicht hofft sie auf die Liebe ihres Lebens, aber sie bleibt ihr versagt. Also macht sie sich auf den Weg in die Großstadt, verdient ihren Lebensunterhalt dreißig Jahre lang mit Arbeit. Und dann, als sie schon alt ist, als ihr ganzes Leben schon fast hinter ihr liegt, dann …

Ob Berta Levi wohl jemals in einem Kino gewesen ist? Gewiss nicht in Haigerloch, denn als Berta dort lebte, gab es noch keine Kinos. In der Synagoge war sie dagegen bestimmt häufig, in der schönen kleinen Synagoge ihres Heimatortes. Berta Levi wurde am 22. Februar 1863 in Haigerloch geboren. Das Städtchen liegt am Rand der Schwäbischen Alb auf hügeligem Grund, hat heute 10.000 Einwohner, Fachwerkhäuser und ein Schloss, das erwartungsgemäß malerisch über den Dächern des Ortes thront.
Der lange und der kurze Teil jüdischer Geschichte in Haigerloch
Nur jüdisches Leben findet sich dort nicht mehr. In Haigerloch bestand über mehrere hundert Jahre eine beachtliche jüdische Gemeinde, die einen eigenen Stadtteil besiedelte und verwaltete, das „Haag“. Der lange Teil der Geschichte der Juden in Haigerloch seit dem 14. Jahrhundert ist eine Erzählung über ihren geduldigen Kampf um eine Gleichstellung bürgerlicher und religiöser Rechte, immerhin unter vergleichsweise günstigen Bedingungen. Die Verfassung und nachfolgende Gesetze des württembergischen Hoheitsgebiets der Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen garantierte spätestens seit 1838 die Religionsfreiheit und weitgehende bürgerliche Rechte auch für Juden. Zu diesem Zeitpunkt stellten sie 32 Prozent der damaligen Gesamtbevölkerung des Städtchens.
Hundert Jahre später zerstörten auch in Haigerloch Nazi-Schläger das Innere der Synagoge und schlugen Fenster der jüdischen Wohnhäuser im Haag ein, nochmal vier Jahre später wurden diejenigen, die nicht geflohen waren, in den Tod deportiert. Das ist der kurze Teil ihrer Geschichte.
Als Berta Haigerloch verließ, war noch alles in Ordnung
Berta Levi wurde also in eine intakte jüdische Gemeinschaft hineingeboren; noch dazu in eine große Familie. Die Archive zählen 15 Geschwister, allerdings sind einige davon schon früh verstorben. Ihr Vater war Viehhändler. Die Synagoge von Haigerloch bildete zusammen mit der Mikwe (dem jüdischen Ritualbad) den Mittelpunkt des jüdischen Gemeindelebens. Die Juden hatten einen eigenen Friedhof, nur wenige Schritte von der Synagoge entfernt. Den Friedhof gibt es noch, und wer heute durch das Haag spaziert, wo noch viele der Häuser stehen, die einmal im jüdischen Besitz waren, vermutet dort damals wie heute ein friedliches Dasein hinter den kleinen Fenstern und alten Mauern.
Mit 33 Jahren verließ Berta Levi diesen idyllischen Ort, als sie 1896 nach München zog. Eine Ehe ging Berta niemals ein, anders als ihre ältere Schwester Mathilde, die da bereits dort lebte, verheiratet mit dem Kaufmann Moritz Camnitzer. Möglicherweise war es diese Verbindung, die Berta (und zwei Jahre später auch ihren jüngeren Bruder Max) veranlassten, sich in München auf die Suche nach Arbeit zu machen. Als Hausangestellte stand sie dann fast dreißig Jahre im Dienst jüdischer Bankiers und Geschäftsleute in München. Ende 1925 war Schluss damit. Ihre Schwester Mathilde war gestorben und sie zog, inzwischen 62 Jahre alt, in den Haushalt ihres Schwagers.
Es gab Kinos in München, und auch genügend Synagogen
Ob sie in diesen Jahren einmal in einem Münchner Kino gewesen ist? Schon gut möglich. Die ersten Kinos wurden in München bald nach 1900 eröffnet. Berta Levi wird in den Haushalten ihrer Herrschaften sich um die Kinder, um die Küche, um die Wäsche und um die Gäste gekümmert haben. Aber sie wird auch freie Tage gehabt haben, vielleicht verliebt gewesen sein, Träume geträumt haben. Bestimmt war sie mal im Kino. War sie religiös praktizierend? Wir wissen es nicht. Wenn sie es war, so gab es genügend Synagogen in München. Vielleicht war sie dort.
Vermutlich ist sie in dieser Zeit auch besuchsweise zurückgekehrt nach Haigerloch. Die Reise aus dem prächtigen München in die schwäbische Provinz war mühsam, aber möglich. Dann wird sie dort an den Feierlichkeiten in der Synagoge teilgenommen haben, die erst 1930 nochmals neu renoviert worden war. Wenn es so war, dann hat sie mitgefeiert bei den großen Festen der Gemeinde, mit ihrer Familie, mit ihren Geschwistern, mit den Nachbarn und Freunden im Haag.
Hörte Berta das Klirren der Scheiben?
Knapp siebzig Jahre alt war Berta Levi, als 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, und die jubelnden braunen Horden durch Berlin und auch durch München zogen. Fünf Jahre später fackelte der Nazi-Mob nicht nur in München und an tausend anderen Orten in Deutschland die Synagogen ab, ermordete und schikanierte Juden und plünderte jüdische Geschäfte. Unwahrscheinlich, dass Berta da an ihrem Geburtsort Haigerloch weilte. Sie wird in München gewesen sein. Blickte sie, die alte Dame, damals aus ihrem Fenster, während unten der braune Schlägertrupp vorbeizog? Hörte sie das Klirren der Scheiben, das Schreien der Verängstigten und Bedrängten, schrie sie mit, oder schüttelte sie nur entsetzt den Kopf? Und wann und wie wird sie davon erfahren haben, dass in dieser Nacht auch in ihrer Heimat-Synagoge in Haigerloch alles kurz und klein geschlagen worden war?
Vier Jahre später, im März 1942 siedelte Berta in ein jüdisches Altenheim in München um. Ob es freiwillig war, wissen wir nicht. War sie krank, bedurfte sie der Hilfe? Was hat sie, nun fast achtzig Jahre alt, noch wahrgenommen vom tödlichen Grauen um sie herum? Im Altenheim war es nur ein kurzer Aufenthalt, denn schon im Juni zwängte man sie in überfüllte Waggons und karrte sie gewaltsam mit Tausenden anderen in das Konzentrationslager Theresienstadt. Dort starb Berta Levi am 11.11.1942 an „Altersschwäche“.
In Haigerloch war das Grauen eingezogen
In Haigerloch war da das friedliche Leben längst vorbei, das Grauen eingezogen. Juden aus den umliegenden Städten wurden nach Haigerloch zwangsweise umgesiedelt und dann von dort in vier Bahntransporten in die Vernichtungslager deportiert. Der letzte Zug verließ Haigerloch am 19. August 1942, also noch zu Lebzeiten von Berta.
Danach lebten keine Juden mehr in Haigerloch. Die Deutschen suchten sich die wertvollsten Stücke aus dem zurückgeblieben Hausrat heraus, und bemühten sich, die leerstehenden Häuser im Haag zugesprochen zu erhalten. Die ausgeplünderte Synagoge erwarb die Stadt Haigerloch bereits 1940 unter repressiven Umständen zu einem Spottpreis. Sie versprach im Kaufvertrag, als Gegenleistung „nach erfolgter Auswanderung der jüdischen Einwohner den Juden-Friedhof in Schutz und Instandhaltung“ zu nehmen. Noch während die drangsalierte jüdische Bevölkerung im Haag lebte, begann die Stadt damit, die ehemalige Synagoge in eine Turnhalle umzubauen. Das Vorhaben konnte nicht zu Ende geführt werden, da kriegsbedingt die Materialien bald fehlten.

Das Gebäude diente in den letzten Kriegsmonaten als Lagerhalle. Ab 1968 war die Synagoge ein Supermarkt, danach eine Lagerfläche für Textilien. Es dauerte bis 1999, mehr als sechzig Jahre nach ihrer Plünderung, bis die Stadt Haigerloch sich ihrer historischen Verantwortung für die Synagoge bewusst wurde. Unter tätiger Mithilfe eines aktiven Kreises örtlicher Unterstützer kaufte sie das Gebäude zurück. Heute wird die ehemalige Synagoge als Museum betrieben, das sehr eindrücklich die Spuren jüdischen Lebens in Haigerloch aufbereitet hat. Endet so diese wahre Geschichte?
Nein, so endet die Geschichte nicht
Nein, die Schlusspointe fehlt. Deshalb endet sie so: Der Krieg ist zu Ende, Berta Levi ermordet wie Millionen Juden. Die Israelitische Kultusgemeinde verlangt die Rückgabe der Synagoge, und nach einigem juristischem Hin und Her geschieht es auch so. Aber es gibt keine Juden mehr, die in Haigerloch eine Synagoge benötigen würden. So verkaufen die jüdischen Sachwalter neun Jahre nach dem Tod von Berta Levi das Gotteshaus ihrer Kindheit an einen Privatmann. Der richtet dort ein Kino ein und betreibt es zehn Jahre lang.
Zu unglaubwürdig? Nein. Erzählt nach einer wahren Geschichte in Deutschland.
————-

Berta Levi ist eine von 1000 jüdischen Persönlichkeiten, an die am 11. April 2024 im Rahmen der Aktion „Die Rückkehr der Namen“ des Bayerischen Rundfunks erinnert wurde. Ich hatte für Berta Levi im Rahmen dieser Aktion eine Patenschaft übernommen. Ihre Lebensdaten finden Sie hier, mehr Informationen zu der Aktion des BR in München hier.
Durch Bert Levi bin ich auf das zerstörte jüdische Leben in Haigerloch aufmerksam geworden. Viele Informationen für diese „wahre Geschichte“ habe ich der Website des Gesprächskreises der ehemaligen Synagoge Haigerloch dem Buch „Erinnerungen an die Haigerlocher Juden – Ein Mosaik“ von Utz Jeggle (Hrsg.) entnommen.
Die ehemalige Synagoge Haigerloch ist als Museum ganzjährig am Samstag und Sonntag, im Sommer auch am Donnerstag Nachmittag geöffnet. Die Dauerausstellung ist eine eindrückliche Spurensammlung, zusammengestellt vom Stuttgarter Haus der Geschichte Baden-Württemberg.

Weitere Texte als #Politikflaneur finden Sie hier.

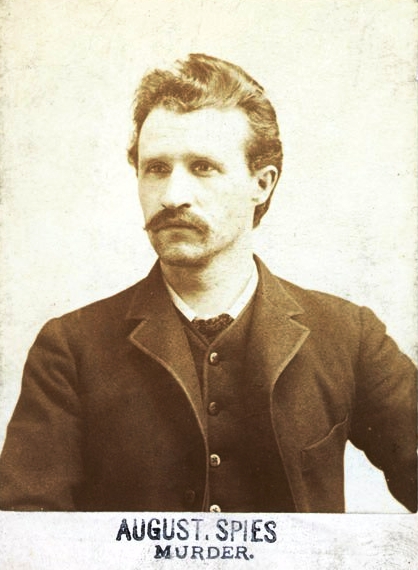










 Die Maisonne wärmt die Straßen der alten Residenzstadt, vom Berg leuchtet die stolze Burg der polnischen Könige. Das Leben beginnt zu pulsieren im jüdischen Viertel, die Bars warten auf verfrühte Nachmittagsgäste, eine Gruppe orthodoxer Juden läuft herum, ihre Locken wippen, während sie Reisekoffer in das Taxi wuchten, das die enge Gasse versperrt. Dort Synagogen, im Stadtzentrum Kirchen. Touristen bestimmen das Bild, viele Europäer in kurzen Hosen und bunten Hemden. In der ganzen Stadt ist fast ausschließlich weiße Haut zu sehen, ein paar Gäste mit asiatisch anmutenden Gesichtszüge. Dann, am Rand der Innenstadt, lockt in einem der alten Häuser das Wort „Döner“. Ein weißer Mann blickt aus dem Fenster. Menschen mit südeuropäischer oder arabischer Prägung gibt es nicht im Straßenbild. Da sage nochmal jemand, Politik habe keine Folgen.
Die Maisonne wärmt die Straßen der alten Residenzstadt, vom Berg leuchtet die stolze Burg der polnischen Könige. Das Leben beginnt zu pulsieren im jüdischen Viertel, die Bars warten auf verfrühte Nachmittagsgäste, eine Gruppe orthodoxer Juden läuft herum, ihre Locken wippen, während sie Reisekoffer in das Taxi wuchten, das die enge Gasse versperrt. Dort Synagogen, im Stadtzentrum Kirchen. Touristen bestimmen das Bild, viele Europäer in kurzen Hosen und bunten Hemden. In der ganzen Stadt ist fast ausschließlich weiße Haut zu sehen, ein paar Gäste mit asiatisch anmutenden Gesichtszüge. Dann, am Rand der Innenstadt, lockt in einem der alten Häuser das Wort „Döner“. Ein weißer Mann blickt aus dem Fenster. Menschen mit südeuropäischer oder arabischer Prägung gibt es nicht im Straßenbild. Da sage nochmal jemand, Politik habe keine Folgen. Ein winziges Café hatte gelockt, und das frisch gemahlene und gebrühte Koffeingebräu war unter schattigen Arkaden ein glücklicher Genuss gewesen, der kleine Kuchen dazu auch. Nun aber würde der Gast eine Toilette benötigen. Die Barista im Rentenalter bedauert, keine eigene Gelegenheit anbieten zu können und gestikuliert deutlich in Richtung Rathaus gegenüber. Richtig, da steht ja: Tourist Information. Aber die Information hat seit 15.30 Uhr geschlossen, nun ist es schon fünf Minuten später, und die Not wird größer. Schließlich Hoffnung: ein anderer Eingang des Rathauses ist noch offen. Schon auf dem Weg zur ersehnten Lokalität stürmt ein Wachmann herbei, verweist grimmig auf seine Uhr und schüttelt entschlossen den Kopf. Ordnung muss sein, Gnade keine Pflicht.
Ein winziges Café hatte gelockt, und das frisch gemahlene und gebrühte Koffeingebräu war unter schattigen Arkaden ein glücklicher Genuss gewesen, der kleine Kuchen dazu auch. Nun aber würde der Gast eine Toilette benötigen. Die Barista im Rentenalter bedauert, keine eigene Gelegenheit anbieten zu können und gestikuliert deutlich in Richtung Rathaus gegenüber. Richtig, da steht ja: Tourist Information. Aber die Information hat seit 15.30 Uhr geschlossen, nun ist es schon fünf Minuten später, und die Not wird größer. Schließlich Hoffnung: ein anderer Eingang des Rathauses ist noch offen. Schon auf dem Weg zur ersehnten Lokalität stürmt ein Wachmann herbei, verweist grimmig auf seine Uhr und schüttelt entschlossen den Kopf. Ordnung muss sein, Gnade keine Pflicht. Gerade erst losgefahren, schon ein erster Halt, ungeplant. Fasziniert hat der Blick durch die Windschutzscheibe. Ein grauer Turm steht da, mit löchriger Haube, rabenumflattert, und das Kirchengebäude daneben ist eine Ruine. Sattes, hohes Grün bahnt sich den Weg durch die gähnend leeren Fensterhöhlen und wiegt sich im Wind, wo das Dach fehlt. Ein Bauzaun versperrt jeden Weg dorthin. Immerhin, drumherum lädt ein großer Friedhof ein. Hunderte Grablaternen, bunte Plastikblumen auf den Gräbern mit polnischen Namen.
Gerade erst losgefahren, schon ein erster Halt, ungeplant. Fasziniert hat der Blick durch die Windschutzscheibe. Ein grauer Turm steht da, mit löchriger Haube, rabenumflattert, und das Kirchengebäude daneben ist eine Ruine. Sattes, hohes Grün bahnt sich den Weg durch die gähnend leeren Fensterhöhlen und wiegt sich im Wind, wo das Dach fehlt. Ein Bauzaun versperrt jeden Weg dorthin. Immerhin, drumherum lädt ein großer Friedhof ein. Hunderte Grablaternen, bunte Plastikblumen auf den Gräbern mit polnischen Namen. Die runde Halle steht in jedem Reiseführer, wird beworben als besondere Sehenswürdigkeit. Unesco-Welterbe! Bei ihrem Bau im Jahr 1927 war die
Die runde Halle steht in jedem Reiseführer, wird beworben als besondere Sehenswürdigkeit. Unesco-Welterbe! Bei ihrem Bau im Jahr 1927 war die  Das ehemalige Bergdorf ist ein Touristenhotspot mit einer alten Holzkirche als herausragende Attraktion. Die Szenerie gleicht der Annäherung an Schloss Neuschwanstein. Vorbei an Hotels und Restaurants nähert sich das Auto, schon frühzeitig lotsen geschäftstüchtige Helfer auf gebührenpflichtige Parkplätze. Der Anstieg von dort zur
Das ehemalige Bergdorf ist ein Touristenhotspot mit einer alten Holzkirche als herausragende Attraktion. Die Szenerie gleicht der Annäherung an Schloss Neuschwanstein. Vorbei an Hotels und Restaurants nähert sich das Auto, schon frühzeitig lotsen geschäftstüchtige Helfer auf gebührenpflichtige Parkplätze. Der Anstieg von dort zur