Wie das Schöne politisch wird – eine Stuttgart-Erfahrung

Ein Pferd sollte her! Wir befinden uns in Stuttgart, das ein Pferd in seinem Wappen führt, weil sein Name sich von einem Garten für Stuten ableitet. Ein stolzes Pferd sollte es also sein!
So oder so ähnlich mögen die Verantwortlichen der ersten Gartenschau am Neckar sich das gedacht haben. Eine „Reichsgartenschau“ sollte 1939 eröffnet werden, und so wurde der Auftrag erteilt, den schönen Park über der Stadt nicht nur mit Hakenkreuz-Flaggen, sondern auch mit einem Denkmal-Pferd zu schmücken.

Wer heute den Schauplatz betritt, der noch immer ein schöner Park ist, muss genau hinsehen, wenn er am Eingang noch ein Pferd erkennen möchte. Ein steinerner Torso fristet dort sein trauriges Dasein, angenagt von Wetter und Zeit. Sollte das hier das stolze Pferd von Stuttgart sein? Man kann es kaum glauben. Und es ist auch das falsche Pferd, zwar drei Jahre früher entstanden, aber erst seit den 70er Jahren hier aufgestellt.
Also ein paar Schritte den Hang aufwärts, hinein in den Park! Dort oben blinkt und lockt es schon im Sonnenlicht, das stolze Pferd von 1939, diesmal ein schmucker Bronzeguss. Dieses Pferd ist zeitlose Kunst, eine Pracht von Kraft und Energie, erstarrt in seiner aufstrebenden Bewegung. Eine Verbeugung vor der Schöpfung, die es vermocht hatte, ein solches schönes Geschöpf entstehen zu lassen.
Die beiden Pferde, der steinerne Torso wie auch das schöne aus Bronze (genauer gesagt: ein Nachguss von 1955) sind zu besichtigen im Höhenpark Killesberg in Stuttgart. Kaum jemand achtet heute auf das verschlissene Steinpferd am Eingang, aber fast jede und jeder Stuttgarter/in kennt den Pferderücken aus Bronze. Keine Kindheit in dieser Stadt, während der man nicht den in luftiger Höhe über der Stadt liegenden Park besucht hätte, seine Spielplätze, die kleine Kirmes, den Aussichtsturm, das Höhencafé, das sommerliche Lichterfest.
Das Bronze-Pferd steht dort mittendrin an zentraler Stelle. Abertausende Stuttgarter Kindesbeine haben schon seinen glattpoliert glänzenden Rücken erstiegen, haben des Hals dieses starren, stolzen Geschöpfs umarmt. „Das größte Glück der Erde …“ – für manches Kind lag es auf diesem Rücken.
Ein Museum, …
Geschaffen hat beide Pferde der Stuttgarter Bildhauer Fritz von Graevenitz, der von 1892 bis 1959 lebte, hochgeachtet als Künstler und bis 1945 Leiter der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Graevenitz entstammte altem württembergischem Militäradel, erlitt schwer Verwundungen im ersten Weltkrieg, aus dem seine beiden Brüder nicht zurückkehrten. Fritz von Graevenitz wusste wohl aus eigenem schmerzhaftem Erleben, was Krieg bedeutet, und vielleicht auch deshalb konzentrierte sich ein großer Teil seines Schaffens ganz politikfern auf die künstlerische Darstellung von Tieren.
Aber leider auch auf Portraitbüsten.
Denn Fritz von Graevenitz erfuhr nicht die Gnade der späten Geburt (wie Helmut Kohl über sich sagte), sondern musste während des Nationalsozialismus leben. Wer hinaufsteigt am Nordwestrand von Stuttgart auf die „Solitude“, das Lustschloss württembergischer Herzöge, kann dort sonntags ein kleines Museum besichtigen, das sich Graevenitz widmet. Viele Tiere in Bild und Skulptur sind dort zu sehen, und auch Portraitbüsten – Darstellungen seiner Frau, seiner vier Töchter in unterschiedlichen Altersstufen, ein frühes Portrait seines Neffen Richard von Weizsäcker.
… das Wichtiges verschweigt
Und – politisch besonders erläutert – die Büste von Rudi Daur, einem evangelisch-pietistisch orientierten Pfarrer, der sich nach dem ersten Weltkrieg für eine Überwindung des Militarismus eingesetzt hatte. Das Vorhandensein dieser Erläuterung ist von Bedeutung, weil sie bewusst ablenkt von dem, was dezidiert nicht zu sehen ist und auch mit keinem Wort erwähnt wird. Fritz von Graevenitz fertigte im Jahr 1935 eine Portraitbüste von Adolf Hitler, die vielmals kopiert im ganzen deutschen Reich zu sehen war.

Im Stuttgarter Graevenitz-Museum aber ist die Zeit stehen geblieben in den 60er Jahren unserer Republik. Hier wird einmal tatsächlich eine sprichwörtliche „Geschichte vom Pferd“ erzählt. Nicht nur, weil sich auch hier mehrere Studien und Gemälde von Pferden finden, sondern weil es keinen Hinweis auf die Rolle des Künstlers im sog. „Dritten Reich“ gibt. Der Kunstfreund, der sich hierhin verirrt, wird im Unklaren gelassen über fragwürdige Aufträge der Nationalsozialisten und verfehlte kulturpolitische Einordnungen, die Graevenitz als Direktor der Stuttgarter Kunstakademie kriegskonformistisch verlauten ließ. Künstlerische Irrtümer und politische Fehltritte waren das. Es steht nicht an, über diese zu richten. Aber ihr Verschweigen durch die Nachkommen darf man als Skandal empfinden.
Trägt das Pferd eine vergiftete Ladung in sich?
Was ein Museumsbesuch bewirken kann! Auch der Blick auf das stolze Bronzepferd von 1939 wandelt sich. Was für eine prachtvolle Darstellung kräftiger Muskelpartien, kein Gramm Fett, keine Spur Dekadenz ist an diesem Tier! Sind wirklich alle Pferde so makellos? War da ein vom Hitlerwahn verblendeter Künstler ästhetisch verliebt in Stärke und Energie, in rassisch überlegene Vitalität, in kriegerischen Durchsetzungswillen, wenige Wochen vor dem deutschen Überfall auf Polen? Trägt das Bronzepferd vom Killesberg ganz nach seinem sagenhaften Vorbild aus Troja eine vergiftete Ladung, eine mörderische List, in sich?
Fritz von Graevenitz musste auch gewusst, vielleicht sogar gebilligt haben, dass jüdische Mitbürger erniedrigt und durch Stuttgarts Straßen getrieben wurden, seine jüdischen Akademiekollegen verfolgt, ihre Synagogen verbrannt waren – während er an ästhetischen Details dieses schönen Pferdes feilte. Während die Stuttgarter am Pferd vorbei durch den Höhenpark flanierten, stand nur wenige Meter entfernt von seinem luftigen Hufschlag jene Halle, in der sich ab Dezember 1941 die geächtet Todgeweihten der Stadt zur Deportation in den Tod einzufinden hatten.

Beladen mit solchen Fragen könnte der Betrachter von heute wieder hinausschreiten aus dem Park, ein paar tausend Schritte hinüber zum Nordbahnhof, wo eine gut versteckt gelegene Gedenkstätte an den Startpunkt der Stuttgarter Deportationszüge in die Todeslager erinnert.
Ein trostloser Weg; immerhin, er führt wieder am steinernen Pferdetorso vorbei. Sein Kalkstein war zu weich für Sturm und Regen und Sonne, zu anfällig für die Luftverschmutzung der modernen Zivilisation. Es ist ein Mahnmal der Vergänglichkeit, und als solches hat es auch etwas Tröstliches.
Über Fritz von Graevenitz kann man sich informieren auf Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_von_Graevenitz und – mit den genannten Einschränkungen – im Graevenitz-Museum bei der Solitude in Stuttgart: http://www.graevenitz-stiftung.de/home . Es gibt dazu auch einen kritischen Hörfunkbeitrag auf SWR 2: https://www.swr.de/swr2/kunst-und-ausstellung/das-stuttgarter-graevenitz-museum-die-luecke-ist-da-ein-bildhauer-und-seine-ns-vergangenheit-100.html
Ganz aktuell (8. Februar 2022): Die Stiftung Geißstraße in Stuttgart will sich in einem Projekt der kulturhistorischen Aufarbeitung des Werkes von Fritz von Graevenitz im Stadtraum von Stuttgart annehmen. Wer Interesse hat, dort mitzuwirken, kann sich bei der Stiftung melden.
Über Geschichte und heutige Gestaltung des Höhenparks Killesberg gibt es hier mehr zu lesen: https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6henpark_Killesberg
Die Gedenkstätte „Zeichen der Erinnerung“ im Inneren Nordbahnhof hat eine eigene, sehr informative Website: http://www.zeichen-der-erinnerung.org/
Weitere Beiträge als #Kulturflaneur finden Sie hier.



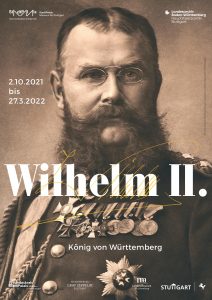

 Der Arc de Triomphe ist groß. Fast fünfzig Meter ragt er in den Himmel, und fast genauso breit umspannen seine mächtigen Pfeiler einen neun Meter breiten Bogen. Als prächtiger Solitär überragt er die Straßen von Paris, die sich um ihn herum verknüpfen in dem vielleicht schönsten Kreisverkehr der Welt. Nach antikem Vorbild vom selbsternannten Kaiser Napoleon initiiert, aber erst lange nach seinem Tod fertiggestellt, wurde er größer als alle seine Vorbilder und Nachahmer. Sogar mit Flugzeugen hat man den Bogen bereits durchflogen. Siegestrunken hindurchmarschieren kann man schon seit dem Ende des 1. Weltkrieges nicht mehr, denn dort ist das Grab eines unbekannten Soldaten platziert – ein prominenter Gedenkort für alle Grauen der Kriege.
Der Arc de Triomphe ist groß. Fast fünfzig Meter ragt er in den Himmel, und fast genauso breit umspannen seine mächtigen Pfeiler einen neun Meter breiten Bogen. Als prächtiger Solitär überragt er die Straßen von Paris, die sich um ihn herum verknüpfen in dem vielleicht schönsten Kreisverkehr der Welt. Nach antikem Vorbild vom selbsternannten Kaiser Napoleon initiiert, aber erst lange nach seinem Tod fertiggestellt, wurde er größer als alle seine Vorbilder und Nachahmer. Sogar mit Flugzeugen hat man den Bogen bereits durchflogen. Siegestrunken hindurchmarschieren kann man schon seit dem Ende des 1. Weltkrieges nicht mehr, denn dort ist das Grab eines unbekannten Soldaten platziert – ein prominenter Gedenkort für alle Grauen der Kriege. Tausende Menschen hasten oder schlendern oder fahren täglich auf diesem Weg unter den Bäumen entlang. Auch für den
Tausende Menschen hasten oder schlendern oder fahren täglich auf diesem Weg unter den Bäumen entlang. Auch für den 
 Unter dem Silberbogen ist der richtige Platz, um über Größe und Kunst nachzudenken. Über die enorme Kreativität und den unfassbaren Mut, die Kunstschaffende jeden Tag aufbringen, um unsere Welt reicher zu machen. Über die Beharrlichkeit und Überzeugungskraft, die es braucht, damit aus einer kühnen Idee Wirklichkeit wird. Über den Mut einer Gesellschaft und ihrer Verantwortlichen, all das zu ermöglichen. In diesem Fall bedeutete das immerhin, vorübergehend unsichtbar zu machen, was für ihre Nation steht, und es damit noch fester zu verankern in der Welt. In anderen Fällen sind es andere Bedingungen – Geld, Räume, Toleranz -, die Kunst ermöglichen. Über die Professionalität und Behutsamkeit, die gefragt ist, damit dabei nichts zu Schaden kommt: nicht der nationale Stolz, nicht das Bauwerk, nicht die Umwelt, nicht seine Besucher. Und auch nicht die künstlerische Idee selbst, die nicht untergehen darf im Sog zur kommerziellen Vermarktung. Ja, dies hier ist ein Event, aber auch ein Triumph des Geistes, der Kultur, der Kunst in großer Vollendung: prächtig, strahlend, für sich selbst sprechend, kostenlos für alle.
Unter dem Silberbogen ist der richtige Platz, um über Größe und Kunst nachzudenken. Über die enorme Kreativität und den unfassbaren Mut, die Kunstschaffende jeden Tag aufbringen, um unsere Welt reicher zu machen. Über die Beharrlichkeit und Überzeugungskraft, die es braucht, damit aus einer kühnen Idee Wirklichkeit wird. Über den Mut einer Gesellschaft und ihrer Verantwortlichen, all das zu ermöglichen. In diesem Fall bedeutete das immerhin, vorübergehend unsichtbar zu machen, was für ihre Nation steht, und es damit noch fester zu verankern in der Welt. In anderen Fällen sind es andere Bedingungen – Geld, Räume, Toleranz -, die Kunst ermöglichen. Über die Professionalität und Behutsamkeit, die gefragt ist, damit dabei nichts zu Schaden kommt: nicht der nationale Stolz, nicht das Bauwerk, nicht die Umwelt, nicht seine Besucher. Und auch nicht die künstlerische Idee selbst, die nicht untergehen darf im Sog zur kommerziellen Vermarktung. Ja, dies hier ist ein Event, aber auch ein Triumph des Geistes, der Kultur, der Kunst in großer Vollendung: prächtig, strahlend, für sich selbst sprechend, kostenlos für alle.








