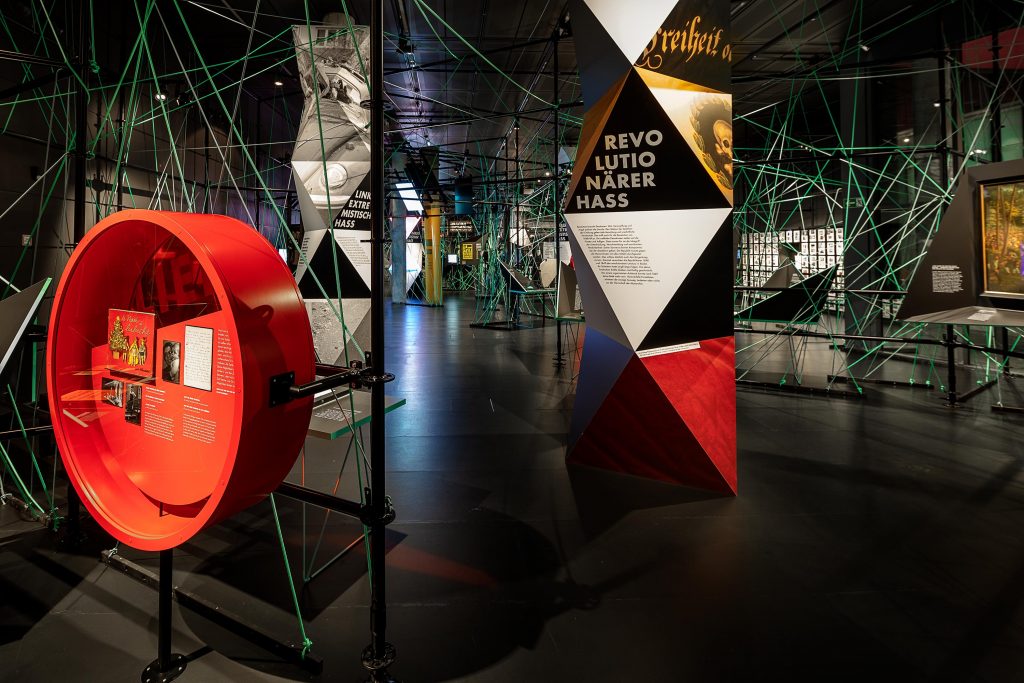Hinaus in die Welt!
Es ist Sommerzeit, die Sonne scheint, mehr als es uns und der Natur guttut. Urlaub steht an, die „wertvollsten Wochen des Jahres“, wie eine Werbung einmal versprach. Viele sind unterwegs, und es ist ihre wohlverdiente Freiheit.

Diese Reise startet in einem ICE: Dicht gedrängt sitzen die Fahrgäste der 2. Klasse. Kein freier Platz, genervte Stimmung, stickige Atmosphäre trotz Klimaanlage. Der vollbesetzte Zug rollt in den Bahnhof ein, einige wenige Passagiere steigen aus, viel mehr steigen ein. Die Neuankömmlinge quetschen sich im Gang aneinander vorbei, es herrscht erhöhte Unruhe. „Au!“ schreit eine Dame auf, kurz dimmt die Lautstärke im anrollenden Waggon herunter, alle schauen sich um, wenige haben etwas gesehen. Die Dame ist Opfer einer Drehbewegung geworden. Sie hat einen Schlag in die Schläfe erlitten.
Voll strahlender Freude eines sommerlichen Aufbruchs, …
Ein junger Mann mit schwarzem Bart im schmalen Gesicht und langen, zu einem lockeren Zopf zusammengebundenen Haaren, schaut sich um nach einem freien Platz, den es nicht gibt. Auch seine Begleiterin blickt wachsam in die Welt, neugierig, freundlich. Das junge Paar im Zug strahlt die ganze Freude aus, die einem sommerlichen Aufbruch innewohnen kann. Noch ein paar Stationen im ICE, nach Frankfurt-Flughafen, dort hinein in das Koloss für weltweite Mobilität, ein paar Stunden des Wartens und Schlangestehens, dann hinein in den Flieger, der sich mit aufheulenden Triebwerken von der Schwerkraft des Bodens lösen wird, nach Amerika, nach Australien, nach Afrika, wohin auch immer – hinaus in die Welt!
… die Welt im Blick, aber nicht den eigenen Rücken.
Jetzt aber haben beide schwere Backpacker-Rucksäcke auf dem Rücken. Sie haben die Welt im Blick, aber eine Wahrnehmung für den Radius, den ihre Rucksäcke raumgreifend erfordern, haben sie nicht. Vielleicht haben sie noch nicht einmal bemerkt, dass der Schmerzenslaut im nervösen Getümmel etwas mit ihnen zu tun hatte. Wenn doch, hätten sie sich bestimmt entschuldigt. Aber sie haben eben keinen Blick nach hinten – keine Rücksicht. Also reibt sich die Dame den Hinterkopf.
Es ist eine privilegierte Form von Freiheit, zum Vergnügen zu reisen
Es setzt voraus, dass man selbst in Freiheit lebt und es sich leisten kann. Milliarden Menschen können nicht aus Spaß unterwegs sein, weil der Staat es ihnen verbietet, oder weil sie zu arm sind, oder alt und krank. Millionen Menschen werden vom Schicksal zu einer „Reise“ gezwungen, weil sie fliehen müssen vor Hunger, Verfolgung, Vernichtung, aber sie kämen niemals auf die Idee, es so zu nennen. Andere können es sich mangels Bildung, oder weil ihnen ein angemessener Zugang zu Information fehlt, noch nicht einmal vorstellen, irgendwohin aufzubrechen. Der Reisbauer in Bangladesch oder der Tagelöhner in Indien kämpft täglich um seine Existenz und denkt nicht ans Reisen. Allenfalls fährt er manchmal im überfüllten Bus zu seiner Familie aufs Land.
Hinaus in die Welt! Der Motor röhrt potent, das Band der Straße flirrt frei und einladend in der Sonnenglut, das Gaspedal gedrückt, die nostalgische Tachonadel erreicht die 200. Vielleicht sind es die Eltern dieses jungen Mannes im ICE mit dem großen Rucksack, die jetzt gerade die Straße unter ihrem Porsche spüren. Draußen strahlt die Sonne, es herrscht Traumwetter, also das Cabrio-Verdeck zurückgefahren, frische Briese um die Nase.
30 Liter Super für eine Spritztour?
Sicher, man könnte zum Abendessen auch beim Italiener um die Ecke einkehren, aber bei diesem Wetter kann man doch auch zum See hundert Kilometer fahren, den Rausch der Geschwindigkeit einsaugen, den Fahrtwind in den Haaren spüren, das Plätschern des Sees hören, den vorbeiziehenden Fähren zugucken. Und dann, nach dem Essen beim Edel-Italiener am Seeufer, geht es zurück nach Hause in der anbrechenden lauwarmen Sommernacht. Dreißig Liter Super verbraucht für die abendliche Spritztour, in die Luft gepustet, das Klima geschädigt. Es war ihre Freiheit.
Dann kommen die Porsche-Eltern heim, zurück in ihre elegante Maisonette-Wohnung, trinken noch ein Glas Wein auf dem Balkon, den Blick auf die nachtglitzernde Stadt. Bald ruhen sie im komfortablen Boxspring-Bett und es ist Nacht, tiefe Nacht, und es sollte Stille sein.
Mit dem Moped um den Globus?
Ist es aber nicht. Unter dem offenstehenden Fenster, das die wohltuend kühle, sternendurchfunkelte Luft hereinströmen lässt, entfaltet sich blubbernd-heulender Krach. Den Lärm hat nicht jemand zu verantworten, der zu dieser frühen Stunde zur Arbeit eilen will. Es ist auch keine Sirene, weil irgendwer in der Not der Hilfe bedürfte. Nein, zu hören ist das Aufheulen eines Mopeds, einmal, wieder, nochmal. Zwei junge Männer stehen um das Gefährt herum, unterhalten sich zu dieser Unzeit lautstark über seine Leistung und Vorzüge, und zum Beweis von Potenz, ihrer eigenen und der des klapprigen Zweirades, lassen sie den Motor aufheulen. Wieder, jetzt wieder. Vielleicht will einer von ihnen morgen früh noch aufbrechen, hinaus in die Welt, mit dem Moped um den Globus- oder wenigstens ans Mittelmeer?
Es wäre seine Freiheit. Aber es gibt keine Freiheit, nachts zur Unzeit und ohne Not zu lärmen, denn es herrscht die gesetzlich bestimmte Nachtruhe. Wo bleibt also die Rücksicht?
Rücksicht begrenzt die Freiheit nicht
Rücksicht begrenzt die Freiheit nicht, sie ermöglicht sie sogar erst, denn ohne Rücksicht finden wir uns in einem kalten Land bösartiger Egoisten wieder. „Rücksicht bedeutet, die Freiheitsräume des anderen zu respektieren“, schreibt der frühere Benediktinermönch Anselm Bilgri. Rücksichtslosigkeit ist ein Krebsgeschwür, an der die Freiheit sterben kann. Sie bildet Metastasen, denn wer Rücksichtslosigkeit erlebt, versteht weniger, warum er selbst rücksichtsvoll sein sollte. Umgekehrt wirkt Rücksicht wie eine Impfung gegen die Kälte im Miteinander: Wer viel Rücksicht ausübt, wirkt ansteckend auf andere. Rücksicht ist eine Haltung, man kann sie durchgängig einnehmen, von früh bis Abend, in der Familie und Ehe, unter Nachbarn, beim Einsteigen in die S-Bahn, beim Verhalten im Restaurant, immer und überall. Rücksicht kostet nichts. Rücksicht macht glücklich.
Vielleicht brauchen wir im Sommer noch ein wenig mehr Rücksicht
Fast scheint es so, als bräuchten wir im Sommer, wir alle unterwegs sind und uns dabei ständig über den Weg laufen, da die Fenster offenstehen und uns mehr verbinden als trennen, noch eine Portion Rücksicht mehr, damit wir frei sein können. Denn es ist die Rücksicht der Stillen, die den Lärmenden ihre Freiheit erst ermöglicht, da wir sonst in einer unerträglich lauten Welt leben würden.
Gute Reise! Aber bitte mit Rücksicht.
Es ist die Rücksicht der Reisenden, ihre sommerliche Reisefreiheit so auszuleben, dass der Schaden für die anderen begrenzt bleibt. Vielleicht geht es ohne Flugzeug? Vielleicht reicht Tempo 100? Vielleicht lässt sich der Co2-Schaden wenigstens kompensieren? Denn auch der Reisende im Auto und Flugzeug profitiert von der Rücksicht der Alten und Kranken und Sesshaften, der Rad- und Bahnfahrer, die mit ihren Steuern helfen, dass eine Autobahn gebaut wurde und das Flugbenzin subventioniert wird.
Also gute Reise! Hinaus in die Welt! Aber bitte mit Rücksicht.
Den klugen Text von Anselm Bilgri über die Rücksicht finden Sie hier: https://anselm-bilgri.de/ruecksicht-eine-forderung-zuerst-an-sich-selbst/
Weitere Texte als #Kulturflaneur finden Sie hier.







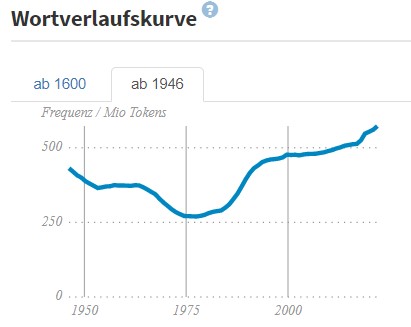
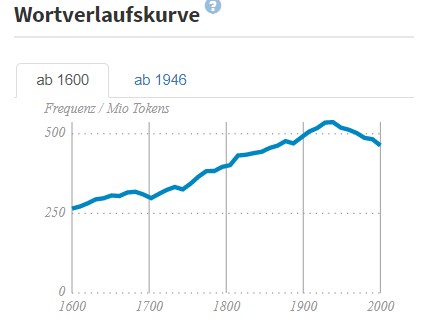


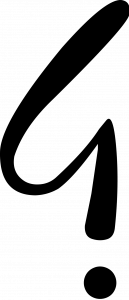
 Was Markus Söder und Thomas Mann gemeinsam haben
Was Markus Söder und Thomas Mann gemeinsam haben