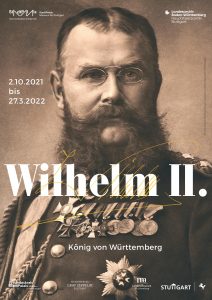E-Mails gab es noch nicht. Also war die Einladung mit der Post gekommen. Billiges Papier, ein grauer, grobfaseriger Briefbogen. Ein Vordruck, die Leerstellen ausgefüllt mit Schreibmaschine.
Der Raum: Eine Amtsstube, Resopaltische, an der Wand ein Foto von Walter Scheel, ein Gummibaum. Graustichige Gardinen an den Fenstern.
Der Prüfling saß alleine an einem Tisch; ihm gegenüber die Kommission: drei ältere Herren, freundlich, graue Haare, graue Anzüge, schlechtsitzende Krawatten. An einem eigenen Tisch rechts daneben: eine Dame mit Hochsteckfrisur, erwartungsvoller Blick über die Schreibmaschine.
Der Gegenstand der Verhandlung: Eine Gewissenprüfung.
Zwei Zeitenwenden sind seither vergangen
Zwei „Zeitenwenden“ sind seither vergangen. Die eine, Herbst 1989, die wir erlebten, als wir mit Tränen in den Augen vor dem gewölbten Bildschirm unseres Röhrenfernsehers hockten. Angespannt und ungläubig starrten wir die verschwommenen Bilder von Menschen an, die auf der Berliner Mauer tanzten, die mit jubelnd-suchendem Blick hindurchtraten durch die wilde, unerwartete Lücke der Geschichte, die hinaustraten in die verheißungsvolle Welt westlich des Brandenburger Tores.
Und dann die andere, Februar 2022: Jetzt sind die Bilder gestochen scharf und sie rühren uns nicht nur an, sie machen Angst. Es sind Bilder eines brutalen Überfalls mitten in Europa, von brennenden Wohnhäusern, von Menschen im fragilen Schutz der Metrostationen, weinend, verzweifelt, ihrer Existenz beraubt und um ihr blankes Leben fürchtend, auf der Flucht. Wir spüren: Das könnten auch unsere Wohnhäuser sein, unsere U-Bahn, unsere Existenz, unser Leben.
Naiv-pazifistische Überzeugung, Angst und Feigheit
Zurück in die Amtsstube von 1977. Der Prüfling wollte nicht zum „Bund“. Es war eine diffuse Mischung, die da zusammenkam. Naiv-pazifistische Überzeugung, aber auch schlotternde Angst vor dem legendär gefürchteten Gebrüll der Grundausbilder, die im Ruf sadistischer Wesenszüge standen. Und bange Feigheit vor der alkoholgeschwängerten Stubenkultur jener Rekruten, die gegen jedes Monatsende an den Bahnhöfen ohrenbetäubend lärmten und randalierten; an deren aggressivem Glück der wiedergewonnenen Freiheit nach ihrer Entlassung aus dem Wehrdienst er sich besser unauffällig vorbeidrückte.

Dem unsportlich-schmächtigen Jugendlichen voller pubertärer Verklemmung und intellektuellem Hochmut schwante nichts Gutes, wenn er sich mit dieser Sorte Gleichaltriger einen Raum mit Stockbetten und Spinden teilen sollte. Die da am Bahnhof, die waren gleichen Schlages wie jene, die dem Grundschüler schon auf dem Schulweg aufgelauert hatten. Das waren die gleichen grobschlächtigen Rabauken, die plötzlich herausgekrochen kamen aus dem schützenden Gebüsch, sich ihrem schwächlichen Opfer in den Weg stellten, voller Vorfreude auf das angebliche Recht des Stärkeren. Sie nahmen den Mitschüler in den „Schwitzkasten“, rissen an seinem Ranzen, zerstreuten den Inhalt auf das staubige Trottoir, verhöhnten seine Tränen. Dorthin wollte er nicht zurück.
Keine Stechmücke töten?
Dann also lieber die Gewissensprüfung. Immerhin, das war sein Terrain. Ganz sicher war sich der Prüfling gewesen in seiner Argumentation: „Ich kann wirklich keiner Fliege etwas tun“, soll er gesagt haben, „auch eine Stechmücke kann ich nicht erschlagen, wenn sie noch so heftig sticht.“ So steht es geschrieben im Schreibmaschinen-getippten Protokoll auf hauchdünn durchscheinendem Durchschlagpapier. „Wenn wir uns in einem gedachten Ernstfall nicht verteidigen“, habe er danach weiterhin ausgeführt, „dann fügt uns der Angreifer weniger Leid zu. Er zwingt uns zwar ein anderes System auf, aber ich kann damit leben. Es gibt weniger Tote, wenn man sich ergibt.“
Aber die drei Herren waren nicht überzeugt. Der Antragsteller habe, so die Begründung der Gewissensprüfer, „für das Empfinden des Ausschusses mitunter zu deutlich übertrieben.“ Der Prüfling habe „taktiert, anstelle ehrlich preiszugeben, was er wirklich empfindet.“
Was für ein Glück der Rechtsstaat bereithält! Auch im Verfahren der Gewissenprüfung für Kriegsdienstverweigerer, das 1983 ganz abgeschafft wurde, gab es ein Widerspruchsrecht. Auch dort: Resopaltische und Gummibaum. Jetzt hing Karl Carstens im Rahmen. Drei andere Herren prüften nun das Gewissen in zweiter Instanz. Erneut galt es, die Gewissennöte darzulegen, und jetzt überzeugten sie dank größerer Demut und besserer Vorbereitung.
Der Prüfling entkam somit erfolgreich gefürchteten fünfzehn Monaten Kommissgebrüll und Stubenterror. Er bezahlte seine Erleichterung mit dem um einen Monat verlängerten Zivildienst, den er in einem neonbeleuchteten Kellerraum damit verbrachte, ungezählte Luftmatratzen auf ihre Dichtigkeit zu prüfen und die mangelhaften zu reparieren. Kiloweise kratzte er Wiesendreck von der Unterseite großer Gruppenzelte, damit die nächsten Jugendgruppen saubere Zeltböden auf erdige Wiesen stellen und ungestört luftgepolstert auf diesen nächtigen konnten.
Das Gleichgewicht war bedrohlich, aber stabil
Es war die Zeit des „Kalten Krieges“. Die atomar bewehrten Weltmächte standen sich in starren Blöcken entlang des „Eisernen Vorhangs“ gegenüber, das Gleichgewicht der Abschreckung war bedrohlich, aber stabil. Es war die Welt, in die Putin zurückwill. Der Prüfling liest seine damalige Argumentation, und sie treibt ihm die Schamesröte ins Gesicht. Wie kann man nur so naiv sein? Nicht mal einer Stechmücke könne er etwas zuleide tun? Das praktische Leben hat das Gegenteil bewiesen. Lieber jede denkbare Gewalt-Knechtschaft erdulden, als sich zu wehren?
Der Prüfling von damals ist heute differenzierter unterwegs: Der Überfall eines Übermächtigen auf einen Schuldlosen, einen Schwachen, empört die Gerechtigkeit. Die blanke militärische Gewalt, nicht oder nur fadenscheinig begründet, schreit nach legitimer Gegenwehr. Der Schwache muss sich doch wehren dürfen, wenn die Raketen oder Panzer seine Wohnhäuser zertrümmern. Dann braucht er eben auch Raketen und Panzer, die das verhindern können. Und dafür braucht es allseits geachtete Menschen, die im Militär ihr Leben aufs Spiel setzen, damit die Möglichkeit erhalten bleibt, Zeilen wie diese hier zu verfassen. Dies alles mit pazifistisch-überheblicher Moral abzutun, ist egoistisch und selbstgerecht.
Ein Plädoyer für Selbstkritik
Selbstkritik ist also angebracht für alle, die es sich – überzeugt davon, dass wir nur noch von Freunden umgeben wären – im Wohlfühl-Pazifismus bequem gemacht haben. Und doch: Auch wer militärische Gegenwehr, Unterstützung mit militärischer Ausrüstung und harte Sanktionen in einem solchen Fall als gerechtfertigte Nothilfe akzeptiert und unterstützt, darf doch immer gleichzeitig auch zweifeln. Wir sollten „wachsam bleiben, jede noch so berechtigte Genugtuung über Waffenlieferungen als Zumutung zu empfinden“, schreibt der Historiker Prof. Roman Birke (Universität Jena) in einem überaus klugen Beitrag in der Süddeutschen Zeitung.
Man darf auch jetzt der sich hochschraubenden Gewaltspirale des Militärischen jederzeit mit Skepsis und Zweifeln begegnen. Eine demokratisch organisierte Gesellschaft kann ihre Regierung unter Schmerzen legitimieren, trotzdem wehrhaft zu handeln. Für den Einzelnen aber bleibt es eine Gewissensentscheidung, ob er oder sie sich mit einer Waffe in die Hand schuldig machen will an Leib und Leben anderer. Und prüfen kann das nur jeder selbst.
Der Aufsatz von Roman Birke ist überaus lesenswert: https://zeitung.sueddeutsche.de/webapp/issue/sz/2022-03-03/page_2.518607/article_1.5540030/article.html
Weitere Texte als #Politikflaneur finden Sie hier. Um den Überfall auf die Ukraine geht es auch in dem Essay „Der Krieg ist da“.