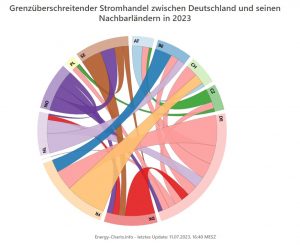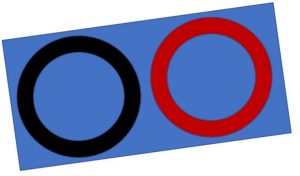Vom „Scheiß in der Jugend“ und was seither geschah – Ein Brief
Hallo Herr Aiwanger,
ich hätte da noch ein paar Fragen! Sie brauchen zwar meine Stimme nicht, ich darf in Bayern nicht wählen. Sie brauchen auch mein Verständnis nicht.
Aber Sie reden ja auch von mir. „Jawohl, auch ich hab´ in meiner Jugend Scheiß gemacht“, haben sie bekenntnismutig gerufen vor ein paar Tagen beim Karpfhamer Volksfest in Niederbayern. „Auch ich“ haben Sie gesagt, und damit haben sich in eine Reihe gestellt mit uns allen, mit Menschen wie auch mich.
Meine Jugend liegt noch fünfzehn Jahre weiter zurück als die Ihre, aber einen Scheiß habe ich da auch schon gemacht. Möglicherweise kann ich mich besser als Sie daran erinnern. Mancher Scheiß war einmalig und lehrreich: Nie wieder wollte ich so ein ertapptes Häufchen Elend sein wie damals, als ich meinen Eltern gestehen musste, dass ich das Geld für den Ausflugsbus der Schülermitverwaltung zwar eingesammelt, aber dann für meine ersten Kneipenbesuche ausgegeben hatte. Und die stümperhaft gefälschte Unterschrift meines Vaters unter die Fünf in der Latein-Schulaufgabe büßte ich mit einer saftigen Ohrfeige, die ich nie vergessen werde, vor allem deshalb, weil mein Vater so gelitten hat an seiner vermeintlichen Pflicht zur Züchtigung.
Erinnern kann ich mich auch ganz genau …
…. an dumme Sprüche darüber, dass nicht alles falsch gewesen sei beim Hitler. Manchmal redeten meine Eltern so daher. Dazu kam, dass wir im Geschichtsunterricht gar nicht bis zum mörderischen „Dritten Reich“ gekommen sind. Immer war das Schuljahr zu Ende, und wir steckten immer noch im langweiligen Mittelalter fest. Auch an unappetitliche Witze über das Schicksal von Juden erinnere ich mich, die wir uns in dem Alter erzählt haben, in dem bei Ihnen ein Flugblatt im Schulranzen gefunden wurde.
Bei mir war es so: Ich habe mitgelacht, auch dümmlich weitererzählt, ahnungslos, denn ich kannte keine Juden. Es waren keine mehr da in unserer kleinen bayerischen Stadt, oder wenn doch, dann gaben sie sich nicht zu erkennen.
Jawohl, auch ich habe in meiner Jugend Scheiß gemacht.
Nun sind Sie in Bayern in einem hohen Staatsamt, und der Scheiß aus Ihrer Jugend wird Ihnen vorgehalten. Sie sind der Meinung, dass das unfair ist, weil es so lange zurückliegt, und halt ein Scheiß aus Ihrer Jugend sei. Damit ich beurteilen kann, ob das wirklich so ist, müsste ich schon ein wenig mehr wissen.
Deshalb kommen hier ein paar Fragen, …
… für die ich mich an meinen eigenen Erinnerungen orientiere, die ich aus den letzten fünfzig Jahren habe:
Waren Sie denn seit Ihrer Strafarbeit von 1987 und – wohlgemerkt! – vor der aktuellen Diskussion um Ihren „Scheiß in der Jugend“, also irgendwann einmal in den letzten 36 Jahren, zu Besuch in Dachau oder Buchenwald? Oder gar in Auschwitz? Treblinka? In Dachau war ich zweimal, und jedes Mal hat mich das dort gezeigte Grauen so tief erschüttert, dass ich schließlich zu feige war, mir das Unbeschreibliche in Buchenwald noch einmal anzusehen. Und das, obwohl ich mehrere Jahre ganz in der Nähe von Weimar gelebt und gearbeitet habe. Es ist diese eigene Feigheit, die mich beschämt, und die ich noch überwinden will. Vor einem Besuch in Auschwitz fürchte ich mich noch mehr. Und auch vor der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Kennen Sie diese Furcht? Diese beiden Orte der Erinnerung habe ich noch nicht besucht. Waren Sie schon dort?

Sind Sie an einem dieser Orte auch stumm geworden …
… angesichts der Leichenberge, der Kisten mit herausgebrochenem Zahngold, der herausgeschmuggelten Fotos nackter Todgeweihter auf dem Weg in die Gaskammern?
Haben Sie es gespürt, das unermessliche, tödliche Grauen, das die sogenannten rechtschaffenen deutschen Bürger dort und an Millionen anderen Stellen angerichtet haben, viele aus fester innerer Überzeugung, vielleicht sogar als schweigende große Mehrheit?
Haben Sie den Film „Schindlers Liste“ gesehen?
Haben Sie sich auch, so wie ich, gequält herumgewälzt im Kinosessel, um der gewissenlosen, brutalen Unerbittlichkeit der Nazi-Schergen nicht weiter zusehen zu müssen?
Haben Sie „Mein Leben“ von Marcel Reich-Ranicki gelesen? Haben Sie mit ihm und mir gebangt und gelitten, als er von seiner Flucht erzählte, vom unfassbaren Glück, das ihn und seine Frau Tosia beschützte, als er seine letzte und einzige Chance nutzte, den sicher todbringenden Verfolgern im Warschauer Ghetto doch noch zu entkommen?
Haben Sie einmal das Haus der Wannseekonferenz in Berlin besucht?
Haben Sie die eiskalte Sprache des gebeugten Rechtes gelesen, die zynischen Berechnungen nachvollzogen? Oder den Film gesehen, der die Konferenz der Nazimörder vom 20. Januar 1942 in Echtzeit nachstellt? Haben Sie die geschäftsmäßige Normalität dieses Behördentermins nacherlebt, die bleiern-bürokratische Atmosphäre einer lästigen Besprechung wahrgenommen, das dröge Vorbringen von Einzelinteressen ertragen, die niederträchtige Routine eines Verwaltungsalltags mit-durchlitten, in dem es um den Tod von Millionen ging?

Sind Sie schon einmal ganz allein, nur für sich, …
…. durch das Stelenfeld in Berlin gewandert? Haben Sie sich verirrt in diesem steinernen Labyrinth der Sprachlosigkeit, konnten Sie einen Moment innehalten, nachdenken, was es bedeutet, sechs Millionen Menschen auf dem deutschen, historischen, wenn auch nicht eigenen, Gewissen zu haben?

Waren Sie schon einmal im NS-Dokumentationszentrum in München, um zu verstehen, dass das Grauen überall war, an jeder Straßenecke? Ich bin von Stuttgart dorthin gefahren – für Sie sind es von Ihren Ministerium aus nur wenige Schritte.
Waren Sie schon einmal in einem jüdischen Museum?
Mir wurde erst beim Besuch des Jüdischen Museums in Berlin so wirklich bewusst, dass unsere Großväter und Väter mit dem systematischen Töten der Menschen auch eine große Kultur zu zerstören versucht haben. Wann haben Sie das verstanden und auch so empfunden?

Und waren Sie schon einmal auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee? Sind Sie schon einmal dort zwischen den mehr als 100.000 Gräbern herumgewandert, haben die vergessenen Namen gelesen, vor den verfallenden Familiengräbern verharrt, auf deren stolzem Marmor noch viel Platz gewesen wäre, aber nach 1933 niemand mehr bestattet wurde?
Alles das, Herr Aiwanger, liegt hinter mir.
Nichts davon ist ungewöhnlich. Millionen Menschen, die nach 1945 in Deutschland geboren wurden, mussten lernen, dass mancher Scheiß in der Jugend nicht nur irgendein dummer Unsinn war, nicht nur ein Bier zu viel am prallvollen Schanktresen des Lebens. Sondern eine Schuld, die man sich aufgeladen hat.
Nun sagen Sie in Ihren Antworten an Ihren Ministerpräsidenten, man solle Ihnen nach dem Scheiß in der Jugend doch einen „Entwicklungs- und Reifeprozess zugestehen“. Mache ich gerne, Herr Aiwanger, aber dafür bräuchte ich Ihre Antworten. Ich warte!
Der Film „Die Wannseekonferenz“ ist noch bis 17. Januar 2024 in der ZDF-Mediathek verfügbar.
Weitere Texte als #Politikflaneur finden Sie hier.